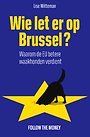I. Einleitung und Überblick.- 1. Ziel und Methode der vorliegenden Untersuchung.- 2. Qualitative Experimente als universelle Methode: Anwendungen in anderen Disziplinen.- 3. Das qualitative Experiment innerhalb Kleinings Systematik wissenschaftlicher Methoden.- II. Analyse der historischen Untersuchungen.- 1. Die Experimente der Würzburger Schule.- 1.1. Die Revision der Methodik Wilhelm Wundts.- 1.2. Die Würzburger Studien: Von elementaristischen zu Strukturalistischen Denktheorien.- 1.3. Karl Bühlers Denkexperimente: Der Dialog als tätige Verrichtung an einem Gegenstand.- 1.4. Unterschiede oder Gemeinsamkeiten: Die Bühler-Wundt-Kontroverse.- 1.5. Das Ende der experimentellen Selbstbeobachtung als Methode.- 2. Das Experiment in der Berliner Gestaltpsychologie.- 2.1. Wertheimers Wahrnehmungsexperimente: Der Dialog als Quelle der experimentellen Variation.- 2.1.1. Die Experimente zum Bewegungssehen.- 2.1.2. Weitere Wahrnehmungsstudien auf dialogischer Basis.- 2.2. Die Studien der Gestaltpsychologen zum Denken.- 2.2.1. Max Wertheimer: Strukturelle Vereinfachung als Variationstechnik.- 2.2.2. Karl Duncker: Lautes Denken und Dialektik.- 2.3. Wolfgang Köhler: Feldstruktur und Isomorphic.- 2.3.1. Erste Experimente zwischen Physik und Psychologie.- 2.3.2. Exkurs: Der Beginn der Tierpsychologie.- 2.3.3. Die Schimpansenexperimente: Forcierung phänomenologischer Erkundungen.- 2.3.4. Die Isomorphiethese: Strukturelle Ähnlichkeit zwischen Phänomenologie und Neurophysiologie.- 2.4. David Katz: Phänomenologie und Experiment.- 2.4.1. Phänomenologische Analyse von Zeichnungen.- 2.4.2. Das Durchschnittsbild als Veranschaulichung des qualitativen Typbegriffs.- 3. Die Methodik in Jean Piagets Genetischem Strukturalismus.- 3.1. Piagets Biographie: Frühe Einflüsse aus Philosophie und Zoologie.- 3.2. Frühwerk: Typologische Kategorisierung der kindlichen Geisteswelt.- 3.2.1. Egozentrismus als allgemeinste Kategorie kindlicher Lebensvollzüge.- 3.2.2. Singuläre Experimente zur Herstellung von Befragungssituationen.- 3.2.3. Zur Aktualität der “Klinischen Methode”.- 3.3. Hauptwerk: Grundlegung einer interaktionistischen Erkenntnistheorie.- 3.3.1. Piagets funktional-genetischer Strukturbegriff: Die Regulationsprinzipien zwischen zwei Systemen.- 3.3.2. Forschungsthemen: Subjektseite der Erkenntnis, Objektseite der Erkenntnis und die Genese der Sprache.- 3.3.3. Zoologische Feldforschung an den eigenen Kindern.- 3.3.4. Auswertung: Vermittlung der Genese und Interaktion von Teil und Ganzem: Das Greifschema als Beispiel.- 3.4. Spätwerk: Experimentelle Analyse begrifflicher Konstruktionen.- 3.4.1. Die “Kritische Methode” als handlungsbezogene genetische Methode.- 3.4.2. Die Technik der experimentellen Variation: Die Entstehung der Zahl als Beispiel.- 3.4.3. Auswertung: Das Verhältnis von Kognition und Aktion.- 3.4.4. Befragung als Forcierung «kognitiver Krisen».- III. Qualitatives Experimentieren im Vergleich.- 1. Qualitative Variation im Experiment.- 1.1. Strukturen oder Konstruktionen als Forschungsgegenstand.- 1.2. Phänomenologische Erkundung, Dialog und genetische Rekonstruktion als Formen der Subjekt-Objekt-Vermittlung.- 1.3. Experimentelle Techniken: Strukturelle, genetische und konflgurationale Transformation.- 1.3.1. Strukturelle Transformationen: Vereinfachung vs. Komplizierung.- 1.3.2. Genetische Transformationen: Beziehungskombinationen und Beziehungsverdichtungen.- 1.3.3. Konflgurationale Transformationen: Experimentelle Eingriffe als Alltagshandlungen.- 2. Möglichkeiten strukturalistischer Theorienbildung.- 3. Probleme qualitativer Auswertung.- 3.1. Beliebigkeit und Subjektivität in der Datenanalyse.- 3.2. Das Verhältnis von Sprache und Gegenstandswelt.- 4. Qualitative und quantitative Fragestellungen: Definition, Funktion und Genese vs. Vergleich, Effizienz und Prognose.- 5. Offenheit als Haltung und als methodisches Prinzip.- IV. Schlußwort.- Literatur.