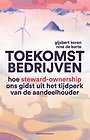1 Grundlagen der Untersuchung.- 1.1 Problemstellung.- 1.2 Zur Relevanz der Bestimmung von finanziellen Entnahmeerwartungen im Rahmen der Hauptfunktionen einer funktionalen Unternehmensbewertungslehre.- 1.2.1 Die Bestimmung der Entnahmeerwartungen im Rahmen der Beratungsfunktion.- 1.2.2 Die Bestimmung der Entnahmeerwartungen im Rahmen der Konfliktlösungsfunktion.- 1.2.2.1 Die Bestimmung eines Arbitriumwertes.- 1.2.2.2 Die Bestimmung eines rechtsgeprägten Schiedswertes.- 1.3 Terminologische Vereinbarungen im Vorfeld der Untersuchung: Festlegung des Prognose- und Retrognosebegriffs.- 1.4 Prognosen als kontrollbedürftige Spekulationen: Auf der Suche nach einem zweckmäßigen Beurteilungsmaßstab für vorgefundene Prognosekonzepte.- 1.4.1 Die Bedeutung essentieller quantentheoretischer Forschungsergebnisse für die Qualität von Prognoseaussagen. Zugleich ein Beleg für die unzureichende Rezeption naturwissenschaftlicher Erkenntnisse bei philosophischen Fragen.- 1.4.2 Die Bedeutung des Postulats der Intersubjektivität wissenschaftlicher Aussagen.- 1.4.3 Der empirische Gehalt (Informationsgehalt) von Aussagen als weiteres Prüfkriterium.- 1.5 Der weitere Gang der Untersuchung.- 1.5.1 Zielsetzung, (Literatur-)Abgrenzung und Untersuchungsmethodik.- 1.5.2 Das relevante Erklärungsmodell zur Prognosegewinnung.- 1.5.3 Vorgehensweise.- 1. Hauptteil Ansätze zur Bewältigung des Prognoseproblems in der älteren Literatur und tradierte Argumentationsweisen im jüngeren Schrifttum.- 2 Bindung der Zielgröße Entnahmeerwartungen an den Substanzwertmaßstab.- 2.1 Historische Wurzel in der Literatur: SCHMALENBACH als Initiator von Erkenntnisbemühungen, mittels Vergleich von Ertrags- und Substanzwert das Konkurrenzrisiko einzufangen.- 2.1.1 SCHMALENBACHs Begründungen einer latenten Konkurrenzgefahr — Ausfluß eines volkswirtschaftlichen Marktmodells?.- 2.1.2 Über den Einfluß volkswirtschaftlicher Fragestellungen auf das weitere Werk SCHMALENBACHs.- 2.1.3 Deutungen der bekannten SCHMALENBACHschen Konkurrenzhypothese durch seine Schüler.- 2.1.4 Zwischenergebnis: Die Konkurrenzhypothese ist dem Modell der vollkommenen Konkurrenz entlehnt. Erste Implikationen für Prognosefragen.- 2.2 Methodologische Untersuchung des Erklärungsmodells der vollkommenen Konkurrenz.- 2.2.1 Erklärungsmodell mit übersituativen Geltungsbereich (A-Modell).- 2.2.2 Beurteilung der Aussagekraft des Erklärungsmodells: Modell-Platonismus.- 2.3 Wissenschaftsgeschichtliche Beurteilung der SCHMALENBACHschen Überlegungen.- 2.3.1 Dogmengeschichtlicher Kurzabriß der Literatur zum relevanten Marktmodell bis 1920: Die Wettbewerbshypothese verkörpert eine lange Tradition im ökonomischen Denken.- 2.3.2 Explikationen der Marktlehre der vollkommenen Konkurrenz in den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts: Einschränkung im Geltungsbereich des Marktmodells.- 2.3.3 Die Wende in der Wettbewerbsforschung nach 1945: Von monokausalen Erklärungsversuchen hin zu komplexen Ansätzen einer Theorienbildung — Relevanz der Ergebnisse für eine moderne Unternehmensbewertung.- 2.3.3.1 Wettbewerb als permanente Abfolge von Aktionen und Reaktionen der Marktpartner- Ablösung vom gleichgewichtsdeterministischen Modelldenken.- 2.3.3.2 Homo Oeconomicus-Vorstellung und Eindeutigkeit der Aussagen im Modell — ein konditionales Verhältnis.- 2.4 SCHMALENBACH und die Folgen: Versuch einer Rezeptionsgeschichte SCHMALENBACHscher Konkurrenzhypothesen im Schrifttum.- 2.4.1 Interpretationen im Sinne der vorgestellten Konkurrenzhypothesen.- 2.4.2 Emanzipationsversuche im Schrifttum: Betriebswirtschaftliche Interpretationsversuche der Konkurrenzproblematik.- 2.5 Unreflektierte Übernahme des Substanzwertes in Kombinationsverfahren.- 2.5.1 Erster Begründungsversuch: Übernommene Sachwerte mindern das Investitionsrisiko des Erwerbers.- 2.5.2 Zweiter Begründungsversuch: Berücksichtigung der Unvollkommenheit der Information durch eine Kombination von Zukunftserfolgs- und Substanzwert.- 2.5.3 Rekurs auf herrschende Methode und Hinweis auf (bewährte) praktische Handhabung und andere sinnverwandte Pseudobegründungszu-sammenhänge.- 3 Ermittlung der Zielgröße Entnahmeerwartungen: Dominanz einfachster mathematisch-statistischer Prognoseverfahren in der älteren Literatur.- 3.1 Schätzung eines Zukunftserfolgs aufgrund modifizierter Vergangenheitsergebnisse.- 3.1.1 Ermittlung eines Vergangenheitsgewinns (Vergleichsgewinn).- 3.1.1.1 Wahl der Referenzperiode.- 3.1.1.2 Korrekturen der einbezogenen GuV-Rechnungen.- 3.1.1.2.1 Korrekturen von Aufwandsposten.- 3.1.1.2.2 Korrekturen von Ertragsposten.- 3.1.1.3 Anwendbarkeit und Aussagegrenzen von (ggf. modifizierten) Durchschnittsrechnungen.- 3.1.2 Fortschreibung der Vergangenheitsergebnisse zum Zukunftserfolg.- 3.1.2.1 Einfache direkte Extrapolation des Vergangenheitserfolgs.- 3.1.2.2 Einfache indirekte Extrapolation des Vergangenheitserfolgs.- 3.1.2.2.1 SCHMALENBACHs Konzeption der relativen Durchschnittsrechnung.- 3.1.2.2.2 Wertschöpfungsrechnung als Indikator der Zukunftserfolge — der Vorschlag von M. R. LEHMANN.- 3.1.2.2.3 LEFFSONs Versuch einer Verbesserung der relativen Durchschnittsrechnung.- 3.1.3 Begründungen für die Verwendung einfacher Extrapolationsmethoden.- 3.1.3.1 Apodiktisches Urteil über die Sinnhaftig-keit der Antizipation zukünftiger Entwicklungen.- 3.1.3.2 Hoher Erklärungswert als Argument.- 3.1.3.3 Fehlen eines adäquaten Instrumentariums zur Erfassung zukünftiger Entwicklungen.- 3.2 Eigenständige Schätzung der Zukunftserfolge — ein Alternativentwurf?.- 3.2.1 MELLEROWICZ’ Plädoyer für reine Ertragswertverfahren und Kritik der theoretisierenden Praxis SCHMALENBACHs als neues Paradigma der Unternehmensbewertungslehre.- 3.2.2 Conditio sine qua non: Gewinnbarkeit prognostisch verwertbarer Informationen.- 3.2.2.1 Marktforschung als uneingeschränkt taugliches Mittel zur Erforschung zukünftiger Entwicklungen in den Märkten nach dem Urteil vieler Sachverständigen zur Unternehmensbewertung.- 3.2.2.2 Differenzierte Beurteilung des Know-how-Potentials durch die Verfahrensentwickler.- 3.2.2.2.1 Zur Frage der Beschaffbarkeit von Informationen über marktliche Entwicklungen.- 3.2.2.2.1.1 Hinführung zur Problemstellung: Träger der Marktforschungsaufgabe.- 3.2.2.2.1.2 Arbeitsgebiete und -Schwerpunkte der einzelnen Träger.- 3.2.2.2.1.3 Ermittlungsprobleme dargelegt an einem Einzelfall: Technischer Fortschritt und Produktinnovation.- 3.2.2.2.2 Über Transformationsprobleme bei der Prognoseerstellung unter Heranziehung von Marktforschungsergebnissen.- 3.2.2.2.2.1 Prolegomena: Marktanalyse und Marktbeobachtung als zentrale Begriffe der Marktforschungslehre Erich SCHÄFERS.- 3.2.2.2.2.2 Marktanalyse verstanden als aktuelle Bedarfsanalyse: Eingeschränkte Übertragungsmöglichkeit von Branchendaten auf unternehmensbezogene Erfolgsrechnungen?.- 3.2.2.2.2.3 Marktbeobachtung interpretiert als Sequenzanalyse. Früheste Prognoseversuche mit begrenzter zeitlicher Vorausschau.- 3.2.2.2.2.4 Über den Aussagewert langfristiger Absatzprognosen — Auszüge aus einer Diskussion in der Marktforschungslehre der fünfziger Jahre.- 3.3 Beurteilung älterer Ansätze zur Lösung des Prognoseproblems im Kontext mit ausgewählten Selbsteinschätzungen dieser Literatur.- 2. Hauptteil Neuansätze zur Bewältigung des Prognoseproblems in der jüngeren Literatur.- 4 Verwendung anspruchsvollerer mathematisch-statistischer Verfahren sowie Simulationsverfahren — ein Ausweg aus dem beschriebenen Dilemma?.- 4.1 Schätzung finanzieller Entnahmeerwartungen mit Hilfe von Regressionsanalysen.- 4.1.1 Modelltheoretische Annahmen und Beschreibung einzelner Modellvarianten in Grundzügen.- 4.1.2 Eignung der Regressionsanalyse für Unternehmensbewertungen im Spiegel fachwissenschaftlicher Beurteilungen.- 4.2 Diskriminanzanalysen als Hilfestellung bei der Prognoseaufgabe?.- 4.2.1 Grundprinzip, Erläuterung einzelner Verfahrensschritte und Anwendungsgrenzen der Diskriminanzanalyse in den Grundlagen.- 4.2.2 Stellung von Diskriminanzanalysen innerhalb des Risikoatlasses von OSSADNICK.- 4.2.2.1 Rationalisierung der Unternehmensbewertung als allgemeiner gedanklicher Ansatzpunkt der Risikoklassifizierung.- 4.2.2.2 Konzeption eines diskriminanzanalytisch gestützten Risikoatlasses — Darstellung und Kritik.- 4.3 Zur Eignung der Simulation als Hilfsmittel der Prognoseerstellung.- 4.3.1 Das Simulationsverfahren und seine Elemente im Überblick.- 4.3.2 Simulationsverfahren zur Unternehmensbewertung in kritischer Sicht.- 4.3.2.1 Der Diskussionsbeitrag von BRETZKE — Darstellung und fachgeschichtliche Rezeption.- 4.3.2.2 Der Vorschlag von BRUNNER — Darlegung und Würdigung im fachwissenschaftlichen Kontext.- 5 Entwicklungsprojekte pragmatischer Prognosemodelle im jüngeren Schrifttum.- 5.1 Teile der Verlautbarung der Wirtschaftsprüfer in kritischer Sicht.- 5.1.1 Fachgeschichtliche Genese.- 5.1.2 Die Phasenmethode als integraler Bestandteil der Methodik der Ertragswertberechnung i.S.d. HFA24.- 5.1.2.1 Überblick über die Bewertungssystematik.- 5.1.2.2 Darstellung und Analyse ausgewählter Ermittlungsschritte.- 5.1.2.3 Die Diskussion um die Phasenmethode -Kritik und Antikritik im Kontext der Methode.- 5.2 Die Konzeption von MOXTER und seinen Schülern.- 5.2.1 Beschreibung des Grundmodells.- 5.2.2 Weitergehende Reflektion ausgewählter Ertragsermittlungsprinzipien.- 5.2.2.1 Das Ertragsfaktorenprinzip in der Diskussion.- 5.2.2.2 Das Schwerpunktplanungsprinzip — zugleich eine Überleitung zum nächsten Abschnitt.- 5.3 Weiterentwicklungsmöglichkeiten der Prognosemodelle unter Rekurs auf spezifische Elemente der strategischen Planung?.- 5.3.1 Der Produktlebenszyklus.- 5.3.1.1 Modelltheoretische Basierung und Beschreibung einer Modellvariante.- 5.3.1.2 Eignung des Konzepts für Unternehmensbewertungen — fachliche Stellungnahmen zum Thema.- 5.3.2 Das Erfahrungskurvenkonzept.- 5.3.2.1 Grundgedanke und Anwendungsgrenzen der Methodik.- 5.3.2.2 Rezeption in der Unternehmensbewertungslehre.- 5.4 Beurteilung neuerer Ansätze zur Lösung des Prognoseproblems im Kontext mit dem modelltheoretischen Ansatz zur Prognosegewinnung von BRETZKE.- 3. Hauptteil Versuch einer Weiterführung der prognoseorientierten Unternehmensbewertung in forschungsstrategischer und pragmatischer Sicht.- 6 Gesamtschau der Bewertungsproblematik in metatheoretischer Sicht unter Entwicklung einer partiellen Gestaltungsalternative für praktische Bewertungen.- 6.1 Der Barriereansatz als Deutungsmuster.- 6.2 Heurismen als Ausweg bei offenkundigem Theoriedefizit, aber praktischem Handlungsbedarf.- 6.2.1 Exemplarische Beispiele für relevante Synthesebarrieren bei der prognoseorientierten Unternehmensbewertung.- 6.2.2 Heurismen im denkpsychologischen Kontext.- 6.2.2.1 Fragmentarische Bemerkungen über kognitive Strukturen.- 6.2.2.2 Synthetisches Problemlösen: Rekurs auf Ent-deckungsheurismen als ein Artefakt zweckmäßiger Informationssuche.- 6.3 Ein angewandter Entdeckungsheurismus: Das Konzept der kritischen Erfolgsfaktoren.- 6.3.1 Deskription.- 6.3.2 Anwendungsgrenzen.- 7 Hauptergebnisse der Untersuchung.- Anlage.