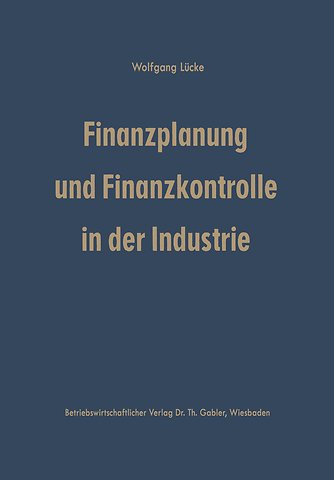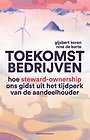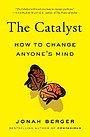Einleitung: Die finanzielle Rationalisierung.- Erstes Kapitel: Die Güter- und Geldströme als Grundtatbestände des industriellen Rechnungswesens.- I. Die Güter- und Geldströme.- 1. Die Aufgabe der Industriebetriebe.- 2. Die Güterströme.- 3. Die Geldströme.- II. Die Kategorien Einzahlungen, Auszahlungen, Einnahmen, Ausgaben, Kosten, Aufwendungen, Erträge, Leistungswerte, Umsätze und Erlöse.- 1. Einzahlungen und Auszahlungen.- 2. Einnahmen und Ausgaben.- 3. Die Bestandsveränderungen durch Ausgaben und Einnahmen.- 4. Die Abgrenzungen der Einnahmen und Ausgaben von anderen Begriffen im Rechnungswesen.- 5. Finanzrechnung und Finanzplanungsrechnung.- 6. Finanzrechnung und pagatorische Rechnungstheorie.- 7. Finanzrechnung und Theorie der Zahlungsreihe.- Zweites Kapitel: Die Grundsätze der Finanzplanung in Industriebetrieben.- I. Das Wesen der Finanzplanung und der Inhalt der Finanzpläne.- 1. Das Wesen der Planung, speziell der Finanzplanung.- 2. Der Inhalt der Finanzpläne.- 3. Der Zusammenhang der Finanzpläne mit den übrigen Plänen in der Unternehmung.- a) Die verschiedenen Pläne in der Unternehmung.- b) Der Planungszusammenhang.- c) Die Frage nach dem Ausgangsplan.- 4. Die Zwecke der Finanzplanung.- 5. Die Entwicklung des Finanzplanungsgedankens.- II Die Anforderungen an die Finanzplanung und Finanzpläne.- III. Die verschiedenen Zeitbegriffe in der Finanzplanung.- 1. Die Länge der Planungsperiode.- 2. Die Anordnung der Teilperioden.- 3. Die Begriffe Kalkulationszeitraum und Bezugszeitpunkt.- 4. Die Veränderung der Anfangs- und Endpunkte der Planungsperioden bei der Planaktualisierung.- Drittes Kapitel: Die Bedeutung und die Bestimmung der Erwartungszahlen im Rahmen der Finanzplanung.- I. Die originären und die derivativen Erwartungszahlen.- II. Die Bestimmung der Erwartungszahlen.- 1. Die Bestimmung der originären Erwartungszahlen.- 2. Die Bestimmung der derivativen Erwartungszahlen.- Viertes Kapitel: Die Planung der Einnahmen und Ausgaben.- I. Die Planung der Forderungszugänge und Einzahlungen.- II. Die Planung der Schuldenzugänge und Auszahlungen.- III. Die Planung der Forderungsabgänge und Schuldenabgänge.- Fünftes Kapitel: Die Gegenüberstellung von geplanten Einnahmen und Ausgaben.- I. Die Gegenüberstellung einfacher Teilperiodenzahlen.- II. Die Gegenüberstellung kumulierter Teilperiodenzahlen.- III. Die Planung der Bestände.- IV. Die finanziellen Anpassungsmaßnahmen.- 1. Anpassungsmaßnahmen auf der Seite der Einzahlungen und Forderungsabgänge.- 2. Die Anpassungsmaßnahmen auf der Seite der Auszahlungen und Schuldenabgänge.- 3. Anpassungsmaßnahmen auf der Seite der Forderungszugänge.- 4. Anpassungsmaßnahmen auf der Seite der Schuldenzugänge.- Sechstes Kapitel: Die Finanzkontrolle.- I. Das Wesen und die Notwendigkeit der Finanzkontrolle.- II. Die Berechnung der Abweichungen.- 1. Die Abweichungen bei den Bewegungsgrößen.- 2. Die Abweichungen der Zahlungsdifferenzen und Finanzdifferenzen.- 3. Die Bestandsabweichungen.- 4. Die Bedeutung der Abweichungen für die Unternehmungspolitik und die weitere Finanzplanung.- III. Finanzkontrolle und Buchhaltung.- 1. Das Zusammenwirken von Finanzkontrolle und Buchhaltung.- 2. Die Finanzflußrechnung.- 3. Finanzkontrolle und funktionale Kontorechnung.- Siebtes Kapitel: Mit der Finanzplanung verbundene Probleme.- I. Die Finanzplanung bei Investitionsüberlegungen.- 1. Finanzdiskontierungsreihen und Kosten-Ertragsdiskontierungsreihen.- 2. Die finanzielle Nebenbedingung im Entscheidungskalkül der Investitionsrechnung.- II. Abschreibungen als Finanzierungsquelle.- 1. Die Ersatzbeschaffung.- 2. Die Neuinvestition aus freien Abschreibungsbeträgen.- 3. Die Wirkung bilanzieller Abschreibungen auf die Einzahlung.- III. Die Abhängigkeit der Finanzplangrößen von der Beschäftigung und der Verkaufsmenge.- IV. Die Planung der finanziellen Preisuntergrenze.- V. Optimale Auflegungszahl und Bestellmenge.- VI. Finanzplanung und Finanzbedarfsrechnung.- VII. Die Bedeutung der Finanzplanung für Liquiditätsüberlegungen.- 1. Begriffserklärung und Berechnungsmethoden der Liquidität in der betriebswirtschaftlichen Literatur.- 2. Der Zusammenhang zwischen Finanzplan und Liquidität.- 3. Liquidität und Rentabilität.- Achtes Kapitel: Der Finanzbericht.- 1. Die Berechnung der Normalfunktionen.- 3. Beispiel zur Berechnung der Saisonindizes.- 4. Die Zahlungsgewohnheit.- 5. Die Einteilung der Abszisse in Abbildung 12.- 6. Der Lag zwischen Produktions- und Absatzmenge.- 7. Die optimale Auflegungszahl.- 8. Die Kapitalbedarfsmenge nach Kolbe.- 9. Der Grad der monetären Transformierbarkeit.- 10. Die maximale Rentabilität.- Autorenregister.