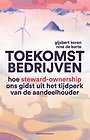A Kurzfassung.- 1 Kurzfassung der einzelnen Kapitel.- 2 Zentrale Handlungsempfehlungen.- B Einführung.- C Fünf Jahre nach der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro.- 1 Einleitung.- 2 Internationale Politik zum Globalen Wandel.- 2.1 Atmosphäre.- 2.1.1 Montrealer Protokoll.- 2.1.2 UN-Rahmenkonvention über Klimaänderungen.- 2.2 Hydrosphäre.- 2.2.1 Schutz der Meere vor landseitigen Einleitungen.- 2.2.2 Überfischung.- 2.2.3 Internationaler Seegerichtshof in Hamburg.- 2.3 Biosphäre.- 2.3.1 Übereinkommen über die biologische Vielfalt.- 2.3.2 Zwischenstaatlicher Wälder-Ausschuß.- 2.3.3 Verhandlungen zu pflanzengenetischen Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft.- 2.4 Lithosphäre/Pedosphäre.- 2.5 Bevölkerung.- 2.5.1 UN-Konferenz für Bevölkerung und Entwicklung (Kairo).- 2.6 Gesellschaftliche Organisation.- 2.6.1 UN-Weltfrauenkonferenz (Peking).- 2.6.2 Weltsiedlungskonferenz Habitat II (Istanbul).- 2.6.3 Weltmenschenrechtskonferenz (Wien).- 2.7 Wirtschaft.- 2.7.1 Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen/ Welthandelsorganisation.- 2.7.2 Welternährungsgipfel der Vereinten Nationen (Rom).- 2.7.3 Weltsozialgipfel der Vereinten Nationen (Kopenhagen).- 3 Lokale Politik zur Umsetzung der Agenda21.- 3.1 Bedeutung lokaler Politikprozesse für eine nachhaltige Entwicklung.- 3.2 Die Lokale Agenda 21.- 3.2.1 Beteiligung der Kommunen am LA21-Prozeß.- 3.2.2 Aktivitäten zur LA21 im internationalen Vergleich.- 3.2.3 Deutsche LA21-Initiativen.- 3.2.4 Mit der LA21 zu einer nachhaltigen Entwicklung: Potentiale und Barrieren.- 4 Fazit und Ausblick.- D Schwerpunktteil: Wasser.- 1 Die Süßwasserkrise: Grundlagen.- 1.1 Wasserfunktionen.- 1.1.1 Naturfunktionen.- 1.1.1.1 Lebenserhaltungsfunktion.- 1.1.1.2 Lebensraumfunktion.- 1.1.1.3 Regelungsfunktionen.- 1.1.2 Kulturfunktionen.- 1.2 Wasser als Lebensraum und seine Bedeutung für angrenzende Lebensräume.- 1.2.1 Stehende Gewässer.- 1.2.2 Fließende Gewässer.- 1.2.3 Boden- und Grundwasser.- 1.2.4 Feuchtgebiete.- 1.2.5 Biodiversität limnischer Ökosysteme.- 1.2.6 Handlungs- und Forschungsempfehlungen.- 1.3 Wasserkreislauf.- 1.3.1 Wasserhaushalt.- 1.3.2 Wasserkreislauf im atmosphärischen Energiehaushalt.- 1.3.3 Wechselwirkungen mit der Atmosphäre.- 1.3.3.1 Strahlung, Wasserdampf und Wolken.- 1.3.3.2 Chemie der Atmosphäre und Aerosole.- 1.3.3.3 Kryosphäre und Ozean.- 1.3.3.4 Vegetation in ariden und semiariden Gebieten.- 1.3.4 Wechselwirkungen mit der Vegetation.- 1.3.4.1 Beeinflussung der Wasserbilanz.- 1.3.4.2 Beeinflussung der Wasserqualität.- 1.3.5 Modell: Wasserkreislauf heute und morgen.- 1.3.5.1 Vergleich zwischen Beobachtung und Simulation des heutigen Klimas.- 1.3.5.2 Simulierte Veränderungen des Wasserkreislaufs unter dem Einfluß eines verdoppelten CO2-Äquivalent-Gehalts.- 1.4 Aktueller Stand und zukünftige Entwicklung der Wasserentnahme in Landwirtschaft Industrie und Haushalten.- 1.4.1 Begriffsdefinitionen und Datenlage.- 1.4.2 Aktueller Stand der Wasserentnahme.- 1.4.3 Entwicklung der Wasserentnahme.- 1.5 Wasserqualität.- 1.5.1 Bestandsaufnahme der Wasserqualität.- 1.5.1.1 Niederschlag.- 1.5.1.2 Oberflächenwasser.- 1.5.1.3 Grundwasser.- 1.5.1.4 Qualitätsüberwachung.- 1.5.2 Qualitätsanforderungen.- 1.5.2.1 Trinkwasser.- 1.5.2.2 Wasser als landwirtschaftliches Produktionsmittel.- 1.5.3 Forschungs- und Handlungsempfehlungen.- 1.6 Wasser und Katastrophen.- 1.6.1 Einleitung.- 1.6.1.1 Entwicklung der Hochwasserschäden.- 1.6.1.2 Vom Starkregen zum Hochwasserschaden.- 1.6.2 Unterscheidung verschiedener Hochwassertypen.- 1.6.3 Einflüsse von Klimaänderungen auf Hochwasser.- 1.6.3.1 Beobachtete Trends in Niederschlag und Abfluß.- 1.6.3.2 Weitere mögliche Änderungen der Hochwasserhydrologie aufgrund von Klimaänderungen.- 1.6.3.3 Möglichkeiten der Modellierung.- 1.6.4 Bewältigung von Hochwasserrisiken.- 1.6.4.1 Ermittlung des Hochwasserrisikos.- 1.6.4.2 Handhabung des Hochwasserrisikos.- 1.6.5 Forschungsempfehlungen.- 2 Wasser im globalen Beziehungsgeflecht — der Wirkungszusammenhang.- 2.1 Trends in der Hydrosphäre.- 2.2 Globale Mechanismen der Wasserkrise.- 2.2.1 Einwirkungen auf die hydrosphärischen Trends.- 2.2.2 Auswirkungen der hydrosphärischen Trends auf andere Sphären.- 3 Die globale Wasserproblematik und ihre Ursachen.- 3.1 Kritikalitätsindex als Maß für die regionale Bedeutung der Wasserkrise.- 3.1.1 Modellierung der Wasserentnahme.- 3.1.2 Modellierung der Wasserverfügbarkeit.- 3.1.3 Wasserspezifisches Problemlösungspotential.- 3.1.4 Formulierung einer Kritikalitätsabschätzung.- 3.2 Syndrome als regionale Wirkungskomplexe der Wasserkrise.- 3.2.1 Wasserrelevanz einzelner Syndrome.- 3.2.2 Systematische Einordnung der Syndrome.- 3.3 Das Grüne-Revolution-Syndrom: Umweltdegradation durch Verbreitung standortfremder landwirtschaftlicher Produktionsmethoden.- 3.3.1 Begriffsbild.- 3.3.1.1 Beschreibung.- 3.3.1.2 Entscheidendes Merkmal.- 3.3.2 Allgemeine Syndromdarstellung.- 3.3.2.1 Syndrommechanismus.- 3.3.2.2 Syndromintensität/Indikatoren.- 3.3.2.3 Syndromkopplungen und -wechselwirkungen.- 3.3.2.4 Allgemeine Handlungsempfehlungen.- 3.3.3 Wasserspezifische Syndromdarstellung.- 3.3.3.1 Wasserspezifischer Syndrommechanismus.- 3.3.3.2 Wasserspezifisches Beziehungsgeflecht.- 3.3.3.3 Wasserspezifische Handlungsempfehlungen.- 3.4 Das Aralsee-Syndrom: Umweltdegradation durch großräumige Naturraumgestaltung.- 3.4.1 Begriffsbild.- 3.4.2 Wasserspezifischer Syndrommechanismus.- 3.4.2.1 Kerntrends an der Mensch-Umwelt-Schnittstelle.- 3.4.2.2 Antriebsfaktoren.- 3.4.2.3 Wirkungen auf die Natursphäre.- 3.4.2.4 Wirkungen auf die Anthroposphäre.- 3.4.2.5 Syndromkopplungen.- 3.4.3 Fallbeispiele.- 3.4.3.1 Aralsee.- 3.4.3.2 Drei-Schluchten-Projekt.- 3.4.4 Indirekte Messung der Intensität.- 3.4.4.1 Messung des Kerntrends „Abflußänderungen auf Landflächen“.- 3.4.4.2 Messung der Vulnerabilität.- 3.4.4.3 Intensität.- 3.4.5 Handlungsempfehlungen.- 3.4.5.1 Minderung der Disposition des Aralsee-Syndroms.- 3.4.5.2 Bewertung wasserbaulicher Großprojekte.- 3.4.5.3 Minderung der Folgen bestehender wasserbaulicher Großprojekte.- 3.4.6 Forschungsempfehlungen.- 3.5 Das Favela-Syndrom: Ungeregelte Urbanisierung, Verelendung, Wasser- und Umweltgefährdung in menschlichen Siedlungen.- 3.5.1 Begriffsbild.- 3.5.2 Allgemeine Syndromdiagnose.- 3.5.2.1 Landflucht, Enttraditionalisierung und ungeregelte Verstädterung.- 3.5.2.2 Politikversagen, Bedeutungszunahme des informellen Sektors und Ausgrenzung.- 3.5.3 Wasserspezifische Syndromdarstellung.- 3.5.3.1 Das Mißverhältnis zwischen Entnahme und Dargebot und seine Folgen.- 3.5.3.2 Wasserverschmutzung und Eutrophierung.- 3.5.3.3 Mangelnde Infrastruktur und ihre Folgen.- 3.5.3.4 Wasserspezifische Gesundheitsgefahren.- 3.5.3.5 Wasserzentriertes Beziehungsgeflecht.- 3.5.3.6 Dynamisches Intensitätsmaß für das Favela-Syndrom.- 3.5.4 Syndromkuration.- 3.5.4.1 Allgemeine Handlungsempfehlungen.- 3.5.4.2 Wasserspezifische Handlungsempfehlungen.- 4 Schlüsselthemen.- 4.1 Internationale Konflikte.- 4.1.1 Grundlagen der Konfliktanalyse.- 4.1.2 Wege zur Konfliktbewältigung.- 4.1.3 Regionale Konflikte um Wasser.- 4.1.3.1 Atatürk-Staudammprojekt am Euphrat-Tigris.- 4.1.3.2 Jordanbecken.- 4.1.3.3 Gabcikovo-Staudamm an der Donau.- 4.1.3.4 Große Seen in Nordamerika.- 4.1.4 Süßwasserdegradation als globales Problem.- 4.1.4.1 Regionale Wasserkonflikte als Sicherheitsbedrohung.- 4.1.4.2 Süßwasserressourcen als „Weltnaturerbe“.- 4.1.4.3 Binnengewässer und Meeresverunreinigung.- 4.1.4.4 „Menschenrecht auf Wasser“.- 4.1.5 Zusammenfassung.- 4.2 Ausbreitung wasservermittelter Infektionskrankheiten.- 4.2.1 Mit Wassernutzung verbundene Krankheiten.- 4.2.1.1 Genuß von verseuchtem Trinkwasser.- 4.2.1.2 Wasserassoziierte Wirte und Überträger von Infektionskrankheiten.- 4.2.2 Trends in der Ausbreitung wasservermittelter Infektionen.- 4.2.3 Handlungsbedarf und -empfehlungen.- 4.3 Wasser und Ernährung.- 4.3.1 Historischer Rückblick.- 4.3.2 Bevölkerungswachstum und Ernährung.- 4.3.3 Ernährung und Wasserverbrauch: Ist-Zustand und Blick in die Zukunft.- 4.3.4 Handlungsempfehlungen.- 4.3.5 Forschungsempfehlungen.- 4.4 Degradation der Süßwasserökosysteme und angrenzender Lebensräume.- 4.4.1 Versalzung und Austrocknung.- 4.4.2 Versauerung.- 4.4.3 Eutrophierung und Verschmutzung.- 4.4.4 Einführung exotischer Arten.- 4.4.5 Überfischung von Binnengewässern.- 4.4.6 Flächen- und Qualitätsverlust von Binnengewässern durch unmittelbare Eingriffe.- 4.4.7 Flächen- und Qualitätsverlust von Feuchtgebieten und ihre Auswirkungen.- 4.4.8 Forschungs- und Handlungsempfehlungen.- 4.5 Wassertechnologien: Grundlagen und Tendenzen.- 4.5.1 Wasserversorgung.- 4.5.1.1 Wassergewinnung.- 4.5.1.2 Wasserverteilung.- 4.5.1.3 Wasseraufbereitung.- 4.5.2 Wassernutzung.- 4.5.3 Wasserentsorgung.- 4.5.3.1 Wassersammlung und -transport.- 4.5.3.2 Wasserreinigung.- 4.5.4 Entwicklungstendenzen und Forschungsbedarf.- 4.5.5 Handlungsempfehlungen.- 5 Wege aus der Wasserkrise.- 5.1 Leitlinien für den „Guten Umgang mit Wasser“.- 5.1.1 Das Leitbild des Beirats.- 5.1.2 Normative Leitlinien für einen „Guten Umgang mit Wasser“.- 5.1.3 Das Leitbild im Lichte jüngerer Entwicklungen der internationalen Ressourcenpolitik und Rechtsauffassung.- 5.2 Soziokulturelle und individuelle Rahmenbedingungen für den Umgang mit Wasser.- 5.2.1 Wasserkulturen: Soziokulturelle Kontexte für den Umgang mit Wasser.- 5.2.1.1 Die wissenschaftlich-technische Dimension.- 5.2.1.2 Die ökonomische Dimension.- 5.2.1.3 Die rechtlich-administrative Dimension.- 5.2.1.4 Die religiöse Dimension.- 5.2.1.5 Die symbolische und ästhetische Dimension.- 5.2.2 Wasserverknappung und Verhalten.- 5.2.3 Wasserverschmutzung und Verhalten.- 5.3 Prinzipien und Instrumente eines nachhaltigen Wassermanagements: Umweltbildung und öffentlicher Diskurs.- 5.3.1 Maßnahmen der Umweltbildung für einen veränderten Umgang mit Wasser.- 5.3.2 Kommunikation und Diskurs.- 5.3.2.1 Grundlagen diskursiver Verständigung.- 5.3.2.2 Kommunikative Formen der Orientierung.- 5.3.2.3 Umsetzung und Anwendung diskursiver Verfahren.- 5.3.3 Empfehlungen.- 5.4 Ökonomische Ansatzpunkte für einen nachhaltigen Umgang mit Wasser.- 5.4.1 Besonderheiten des Wassers.- 5.4.1.1 Multifunktionalität und Bewertungsvielfalt des Wassers.- 5.4.1.2 Divergierende ökonomische Eigenschaften des Gutes Wasser.- 5.4.1.3 Regionaler Charakter der meisten Wasserprobleme.- 5.4.1.4 Steigende Bedeutung der Wirtschaftlichkeit.- 5.4.2 Lösung des Allokationsproblems.- 5.4.2.1 Grundsätzliche Lösungsmöglichkeiten.- 5.4.2.2 Problemlösung über Wassermärkte.- 5.4.2.3 Mindestwasserbedarf und seine Sicherung.- 5.4.3 Vergleich der Wasserwirtschaft in Deutschland und den USA.- 5.4.3.1 Vorbemerkungen.- 5.4.3.2 Wasserwirtschaft in Deutschland.- 5.4.3.3 Wasserwirtschaft in den USA.- 5.4.4 Empfehlungen.- 5.5 Prinzipien und Instrumente des rechtlichen Umgangs mit Wasser.- 5.5.1 Einleitung.- 5.5.2 Wasserhaushaltsrecht in Deutschland.- 5.5.2.1 Rechtliche Regelung der Nutzungsaufteilung in Deutschland.- 5.5.2.2 Öffentliche Trinkwasserversorgung.- 5.5.3 Internationales Süßwasserrecht.- 5.5.3.1 Völkergewohnheitsrechtliche Regeln zur Nutzung grenzüberschreitender Gewässer.- 5.5.3.2 Neuere regionale Verträge.- 5.5.3.3 Fortschritte in der Arbeit der International Law Association.- 5.5.3.4 UN-Konvention zur nicht-schiffahrtlichen Nutzung internationaler Wasserläufe.- 5.5.4 Stärkung der internationalen Mediationsmechanismen zur Konfliktverhütung.- 5.5.5 Stärkung der internationalen Zusammenarbeit zum Schutz von Süßwasserressourcen.- 5.5.5.1 „Global Consensus“ zu Süßwasserressourcen.- 5.5.5.2 Funktionen.- 5.5.5.3 Mögliche institutionelle Ausgestaltung.- 5.5.5.4 Zusammenfassung.- 5.6 Instrumenteneinsatz.- 5.6.1 Erhalt von wertvollen Biotopen (Welterbe).- 5.6.2 Wasserver- und -entsorgung.- 5.6.3 Gesundheit.- 5.6.4 Bewässerung und Ernährung.- 5.6.5 Katastrophenschutz.- 5.6.6 Konfliktschlichtung auf nationaler und internationaler Ebene.- E Forschungs- und Handlungsempfehlungen.- 1 Zentrale Forschungsempfehlungen zum Schwerpunktthema Süßwasser.- 1.1 Sektorales Systemverständnis.- 1.2 Konkretisierung und Beachtung des Leitbildes.- 1.3 Ausgestaltung des Leitbildes.- 1.4 Integriertes Systemverständnis.- 2 Zentrale Handlungsempfehlungen zum Schwerpunktthema Süßwasser.- 2.1 Elemente einer globalen Wasserstrategie.- 2.2 Konkretisierung des Leitbildes.- 2.3 Beachtung und Ausgestaltung des Leitbildes.- 2.4 Ausgewählte Kernempfehlungen zur Vermeidung einer weltweiten Süßwasserkrise.- F Literatur.- G Glossar.- H Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen.- I Index 409.