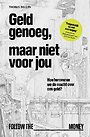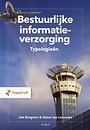Zusammenfassung für Entscheidungsträger.- 1 Einleitung.- 2 Einbindung der Energiesysteme in Gesellschaft und Wirtschaft.- 2.1 Einleitung.- 2.2 Globale Ausgangslage.- 2.2.1 Zunehmende Energie- und Kohlenstoffproduktivität - Trends bis 2020.- 2.2.2 Energienutzung in Sektoren.- 2.2.3 Lebensstile und Energieeinsatz.- 2.3 Energie in den Industrieländern.- 2.3.1 Struktur der Energieversorgung.- 2.3.2 Grundlagen und Ziele der Energiepolitik.- 2.3.3 Liberalisierung der Märkte für leitungsgebundene Energieversorgung.- 2.3.4 Erneuerbare Energien in den Industrieländern.- 2.4 Energie in den Entwicklungs- und Schwellenländern.- 2.4.1 Struktur der Energieversorgung.- 2.4.2 Trends der sektoralen Energienachfrage.- 2.5 Energie in den Transformationsländern.- 2.5.1 Energienutzung.- 2.5.2 Trends in der sektoralen Energienachfrage.- 2.5.3 Subventionierung als Ursache ineffizienter Energienutzung.- 2.5.4 Privatisierung, Liberalisierung und (Re)regulierung der Energiewirtschaft.- 2.6 Wirtschaftliche und geopolitische Rahmenbedingungen.- 2.6.1 Globalisierung als neue Rahmenbedingung energiepolitischen Handelns.- 2.6.2 Geopolitik.- 2.7 Institutionen globaler Energiepolitik.- 2.7.1 Wissensbasis.- 2.7.2 Organisation.- 2.7.2.1 Politische Zieldeklarationen.- 2.7.2.2 Internationale Verträge.- 2.7.2.3 Operative und koordinierende Tätigkeiten internationaler Organisationen.- 2.7.3 Finanzierungsstrukturen.- 2.7.4 Fragmentierte Ansätze einer globalen Energiepolitik.- 2.8 Vorläufiges Fazit: Ausgangslage für globale Energiepolitik.- 3 Technologien und nachhaltige Potenziale.- 3.1 Einleitung.- 3.2 Energieträger.- 3.2.1 Fossile Brennstoffe.- 3.2.1.1 Potenziale.- 3.2.1.2 Technik/Konversion.- 3.2.1.3 Umwelt- und Sozialfolgen.- 3.2.1.4 Bewertung.- 3.2.2 Kernenergie.- 3.2.2.1 Potenziale.- 3.2.2.2 Technik/Konversion.- 3.2.2.3 Umwelt- und Sozialfolgen.- 3.2.2.4 Bewertung.- 3.2.3 Wasserkraft.- 3.2.3.1 Globale Potenziale.- 3.2.3.2 Technik.- 3.2.3.3 Umwelt- und Sozialfolgen.- 3.2.3.4 Bewertung.- 3.2.4 Bioenergie.- 3.2.4.1 Potenziale moderner Bioenergie.- 3.2.4.2 Umwelt- und Sozialfolgen traditioneller Biomassenutzung in Entwicklungsländern.- 3.2.4.3 Bewertung.- 3.2.5 Windenergie.- 3.2.5.1 Potenziale.- 3.2.5.2 Technik/Konversion.- 3.2.5.3 Umwelt- und Sozialfolgen.- 3.2.5.4 Bewertung.- 3.2.6 Solarenergie.- 3.2.6.1 Potenziale.- 3.2.6.2 Technik/Konversion.- 3.2.6.3 Umwelt- und Sozialfolgen.- 3.2.6.4 Bewertung.- 3.2.7 Erdwärme.- 3.2.7.1 Potenziale.- 3.2.7.2 Technik/Konversion.- 3.2.7.3 Umwelt- und Sozialfolgen.- 3.2.7.4 Bewertung.- 3.2.8 Andere erneuerbare Energien.- 3.3 Kraft-Wärme-Kopplung.- 3.3.1 Technologie und Effizienzpotenziale.- 3.3.2 Einsatzmöglichkeiten.- 3.3.3 Wirtschaftlichkeit.- 3.3.4 Bewertung.- 3.4 Energieverteilung, -transport und –speicherung.- 3.4.1 Grundlegende Eigenschaften von Elektrizitätsversorgungsstrukturen.- 3.4.2 Versorgungsstrategien für Elektrizitätsinseln.- 3.4.3 Versorgungsstrategien innerhalb von Elektrizitätsnetzen.- 3.4.3.1 Die fluktuierende Energienachfrage in Elektrizitätsnetzen.- 3.4.3.2 Das fluktuierende Energieangebot aus erneuerbaren Energiequellen.- 3.4.3.3 Strategien zur Abstimmung von Energieangebot und -nachfrage.- 3.4.4 Wasserstoff.- 3.4.4.1 Grundlagen.- 3.4.4.2 Herstellung.- 3.4.4.3 Speicherung und Verteilung.- 3.4.4.4 Nutzung von Wasserstoff.- 3.4.4.5 Potenzielle Umweltschädigungen durch Wasserstoff.- 3.4.5 Elektrizität versus Wasserstoff: Bewertung.- 3.5 Steigerung der Energieeffizienz.- 3.5.1 Effizienzsteigerungen in Industrie und Gewerbe.- 3.5.2 Effizienzsteigerungen und Solarenergienutzung in Gebäuden.- 3.6 Kohlenstoffspeicherung („Sequestrierung“).- 3.6.1 Technisches Kohlenstoffmanagement.- 3.6.2 Potenziale der Speicherung als Biomasse.- 3.6.3 Bewertung.- 3.7 Energie für den Verkehr.- 3.7.1 Technologieoptionen für den Straßentransport.- 3.7.2 Effizienzgewinne durch Informationstechnologie und Raumplanung.- 3.7.3 Nachhaltigkeit und externe Effekte des erhöhten Energiebedarfs für den Transport.- 3.7.4 Bewertung.- 3.8 Zusammenfassung und Bewertung.- 4 Ein exemplarischer Pfad für eine nachhaltige Transformation der Energiesysteme.- 4.1 Ansatz und Methode zur Ableitung eines exemplarischen Transformationspfads.- 4.2 Energieszenarien für das 21. Jahrhundert.- 4.2.1 SRES-Szenarien als Ausgangsbasis.- 4.2.2 Grundannahmen der SRES-Szenarien.- 4.2.3 Emissionen in den SRES-Szenarien.- 4.2.4 IPCC-Klimaschutzszenarien (,,Post-SRES“-Szenarien).- 4.2.5 Technologiepfade in der AI-Welt.- 4.2.5.1 Vergleich der Energiestrukturen und Klimaschutzstrategien.- 4.2.5.2 Rolle der Kohlenstoffspeicherung.- 4.2.5.3 Vergleich der Kosten.- 4.2.5.4 Umweltauswirkungen.- 4.2.6 Auswahl eines Szenarios zur Entwicklung eines exemplarischen Pfads.- 4.3 Leitplanken für die Transformation der Energiesysteme.- 4.3.1 Ökologische Leitplanken.- 4.3.1.1 Schutz der Biosphäre.- 4.3.1.2 Klimaschutzfenster.- 4.3.1.3 Nachhaltige Flächennutzung.- 4.3.1.4 Biosphärenschutz in Flüssen und ihren Einzugsgebieten.- 4.3.1.5 Schutz der Meeresökosysteme.- 4.3.1.6 Schutz der Atmosphäre vor Luftverschmutzung.- 4.3.2 Sozioökonomische Leitplanken.- 4.3.2.1 Schutz der Menschenrechte.- 4.3.2.2 Zugang zu moderner Energie.- 4.3.2.3 Individueller Mindestbedarf an Energie.- 4.3.2.4 Anteil der Energieausgaben am Einkommen.- 4.3.2.5 Gesamtwirtschaftlicher Mindestentwicklungsbedarf.- 4.3.2.6 Technologierisiken.- 4.3.2.7 Gesundheitsfolgen der Energienutzung.- 4.4 Ein exemplarischer Transformationspfad für die Energiewende zur Nachhaltigkeit.- 4.4.1 Ansatz und Methode.- 4.4.2 Modifikation des Szenarios A1T-450 zum exemplarischen Pfad.- 4.4.3 Der Technologiemix des exemplarischen Pfads im Überblick.- 4.4.4 Fazit: Die globale Energiewende ist möglich.- 4.5 Diskussion des exemplarischen Pfads.- 4.5.1 Das MIND-Modell.- 4.5.2 Der exemplarische Pfad: Bedeutung, Unsicherheiten und Kosten.- 4.5.2.1 Unsicherheiten bei den erlaubten Emissionsmengen.- 4.5.2.2 Kosten des exemplarischen Transformationspfads und Finanzierbarkeit.- 4.6 Fazit.- 5 Die WBGU-Transformationsstrategie: Wege zu global nachhaltigen Energiesystemen.- 5.1 Kernelemente einer Transformationsstrategie.- 5.2 Handlungsempfehlungen für die Länderebene.- 5.2.1 Ökologische Finanzreformen.- 5.2.1.1 Internalisierung externer Kosten bei fossiler und nuklearer Energie.- 5.2.1.2 Abbau von Subventionen für fossile und nukleare Energie.- 5.2.1.3 Fazit.- 5.2.2 Fördermaßnahmen.- 5.2.2.1 Förderung erneuerbarer Energien.- 5.2.2.2 Förderung fossiler Energien mit verringerten Emissionen.- 5.2.2.3 Förderung der Effizienz bei der Bereitstellung, Verteilung und Nutzung von Energie.- 5.2.2.4 Fazit.- 5.2.3 Moderne Energieformen und effizientere Energienutzung in Entwicklungs-, Transformations- und Schwellenländern.- 5.2.3.1 Die Grundidee.- 5.2.3.2 Konkrete Schritte auf der Angebotsseite.- 5.2.3.3 Konkrete Schritte auf der Nachfrageseite.- 5.2.3.4 Fazit.- 5.2.4 Flankierende Maßnahmen in anderen Politikbereichen.- 5.2.4.1 Klimapolitik.- 5.2.4.2 Verkehr und Raumordnung.- 5.2.4.3 Landwirtschaft.- 5.2.4.4 Fazit.- 5.3 Handlungsempfehlungen für die globale Ebene.- 5.3.1 Ausbau der internationalen Strukturen für Forschung und Beratung im Energiebereich.- 5.3.2 Institutionelle Verankerung globaler Energiepolitik.- 5.3.2.1 Funktionen internationaler Institutionen.- 5.3.2.2 Entwicklung einer Weltenergiecharta.- 5.3.2.3 Auf dem Weg zu einer „Internationalen Agentur für nachhaltige Energie“.- 5.3.3 Finanzierung der globalen Energiewende.- 5.3.3.1 Prinzipien einer gerechten und effizienten Finanzierung globaler Energiepolitik.- 5.3.3.2 Aufbringung neuer und zusätzlicher Finanzmittel.- 5.3.3.3 Verwendung der Mittel für die Energiewende durch international Finanzinstitutionen.- 5.3.4 Ausrichtung der internationalen Klimaschutzpolitik auf die Energiewende.- 5.3.5 Abstimmung der internationalen Wirtschafts- und Handelspolitik mit den Zielen einer nachhaltigen Energiepolitik.- 5.3.5.1 Abschluss eines Multilateralen Energiesubventionsabkommens (MESA).- 5.3.5.2 Transformationsmaßnahmen im Rahmen von GATT/WTO.- 5.3.5.3 Präferenzielle Abkommen im Energiesektor.- 5.3.5.4 Technologietransfer und das TRIPS-Abkommen.- 5.3.5.5 Liberalisierung des Weltmarkts für Energiegüter?.- 5.3.5.6 Rechte und Pflichten für Direktinvestoren.- 5.3.6 Ausstieg aus der Kernenergie.- 5.3.7 Entwicklungszusammenarbeit: Energiewende durch globale Strukturpolitik gestalten.- 5.3.8 Initiierung von Modellprojekten mit weltweiter Signalwirkung.- 6 Forschung für die Energiewende.- 6.1 Systemanalyse.- 6.2 Gesellschaftswissenschaftliche Forschung.- 6.3 Technologieforschung und -entwicklung.- 6.3.1 Technologien zur Energiebereitstellung aus erneuerbaren Quellen.- 6.3.2 Systemtechnologien einer nachhaltigen Energieversorgung.- 6.3.3 Entwicklung von Verfahren zur effizienteren Energienutzung.- 7 Stationen des WBGU-Transformationsfahrplans: politische Zielgrößen, Zeitpläne und Maßnahmen.- 7.1 Von der Vision zur Umsetzung: Chancen der nächsten 10–20 Jahre nutzen.- 7.2 Natürliche Lebensgrundlagen schützen.- 7.2.1 Emission von Treibhausgasen drastisch reduzieren.- 7.2.2 Energieproduktivität erhöhen.- 7.2.3 Erneuerbare Energien erheblich ausbauen.- 7.2.4 Aus der Kernkraft aussteigen.- 7.3 Energiearmut weltweit beseitigen.- 7.3.1 Globale Mindestversorgung anstreben.- 7.3.2 Internationale Zusammenarbeit auf nachhaltige Entwicklung ausrichten.- 7.3.3 Handlungsfähigkeit der Entwicklungsländer stärken.- 7.3.4 Regulatorische und privatwirtschaftliche Elemente kombinieren.- 7.4 Finanzmittel für die globale Energiewende mobilisieren.- 7.5 Modellprojekte als strategischen Hebel nutzen und Energiepartnerschaften eingehen.- 7.6 Forschung und Entwicklung vorantreiben.- 7.7 Institutionen globaler Energiepolitik bündeln und stärken.- 7.7.1 Koordinationsgremium gründen und Weltenergiecharta aushandeln.- 7.7.2 Politikberatung international verbessern.- 7.8 Fazit: Politische Gestaltungsaufgabe jetzt wahrnehmen.- 8 Literatur.- 9 Glossar.- 10 Index.