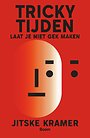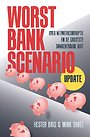1. Kooperation als Problem des Elterntrainings.- 1.1. Ausfallquoten beim Elterntraining.- 1.2. Literaturübersicht zur Erklärung der Ausfallquoten.- 1.2.1. Eltern werden unkooperativ, wenn sie durch die Therapie Annehmlichkeiten aufgeben müssen.- 1.2.2. Eltern werden unkooperativ, wenn die Therapie des Kindes zum Verlust von sekundärem Krankheitsgewinn führt.- 1.2.3. Eltern werden unkooperativ, wenn die Mitarbeit bei der Therapie des Kindes Unannehmlichkeiten mit sich bringt.- 1.2.4. Eltern sind unkooperativ, wenn sozio-ökonomische Verhältnisse die Mitarbeit an der Therapie des Kindes hindern.- 1.2.5. Andere Faktoren, die Kooperativität der Eltern bei der Therapie des Kindes bestimmt haben.- 1.3. Phänomenologie des Problemfeldes.- 1.3.1. Unkooperativität als Reaktion der Eltern auf besondere Belastungen durch die Methode des Trainings.- 1.3.2. Unkooperativität der Eltern als Reaktion auf Unkooperativität des Therapeuten.- 1.4. Faktoren der Kooperativität, die unabhängig von der Phase des therapeutischen Prozesses wirksam sind.- 1.4.1. Fähigkeit, Einstellung und Leidensdruck.- 1.4.2. Persönlichkeitsvariablen.- 1.4.3. Familiäre Bedingungen.- 1.4.4. Soziale und ökonomische Bedingungen der Familie.- 1.4.5. Außerfamiliäre Bedingungen der Motivation zur Co-Therapie.- 2. Fragestellung und Konzept der empirischen Untersuchung.- 2.1. Der Ausgangspunkt und das Problemfeld der Arbeit.- 2.2. Spezielle Fragestellung und Anliegen der Arbeit.- 2.3. Theoretischer Standort und das Modell der therapeutischen Kooperation.- 2.4. Rechtfertigung der Gliederung im Modell.- 3. Der Begriff der Kooperativität und die Kooperationsskalen.- 3.1. Der Begriff Kooperativität.- 3.2. Die Kooperativitätsskala zur Erfassung der erzieherischen Fähigkeit (Koop 1).- 3.3. Die Kooperativitätsskala zur Erfassung des erzieherischen Engagements (Koop 2).- 3.4. Vergleich der Skalen.- 4. Die Fragebogen der Untersuchung zur Erfassung der unabhängigen Variablen der Kooperativität.- 4.1. Der Persönlichkeitsfragebogen zur Extraversion und Neurotischen Tendenz (EN).- 4.2. Der Mutterfragebogen (MF). Die Variablen des sozialen Kontextes.- 4.2.1. Item-Hypothesen und Itemkonzept.- 4.2.2. Bewertungsschlüssel der Items des Mutterfragebogens.- 4.2.3. Statistische Analyse.- 4.2.4. Validität, Trennschärfe und Schwierigkeit der ausgelesenen Items.- 4.3. Der soziographische Fragebogen (SF) zu den starren Situationsvariablen.- 5. Stichprobe und Durchführung der Untersuchung.- 5.1. Einschränkung der Population auf Mütter geistig behinderter Kinder einer Sonderschule.- 5.2. Beschreibung der Stichprobe.- 5.3. Durchführung der Untersuchung.- 6. Ergebnisse.- 6.1. Prüfung der Ausgangslage — Teilnahme an der Untersuchung und Kooperativität.- 6.1.1. Die Ausfallquote der von den Müttern beantworteten Fragebogen.- 6.1.2. Die Ausfallquote im SF.- 6.2. Ergebnisse aus dem Fragebogen zur Extraversion und Neurotischen Tendenzen.- 6.2.1. Neurotische Tendenz und Kooperativität.- 6.2.2. Extraversion und Kooperativität der Mütter.- 6.2.3. Zusammenfassung der Ergebnisse des EN.- 6.3. Ergebnisse aus dem Mütterfragebogen (MF).- 6.3.1. Aussagen der Mutter zur eigenen Person.- 6.3.2. Aussagen der Mutter zu allgemeinen Fragen der Erziehung.- 6.3.3. Aussagen der Mutter, die ihre Beziehung zum geistig behinderten Kind beschreiben.- 6.3.4. Aussagen der Mutter, die ihre Beziehung zur übrigen Familie betreffen.- 6.3.5. Beziehung der Familie zur Nachbarschaft.- 6.3.6. Aussagen der Mutter zur Therapie.- 6.3.7. Zusammenfassung der Aussagen im Mutterfragebogen, die Nichtkooperativität indizieren.- 6.4. Ergebnisse des soziographischen Fragebogens (SF).- 6.4.1. Alter der Mutter und des Problemkindes.- 6.4.2. Familienstand der Mutter.- 6.4.3. Schulbildung der Mutter.- 6.4.4. Beruf des Vaters.- 6.4.5. Berufsbildung der Mutter.- 6.4.6. Berufsbildung des Vaters.- 6.4.7. Entscheidungsbefugnis der Mutter im Beruf.- 6.4.8. Entscheidungsbefugnis des Vaters im Beruf.- 6.4.9. Berufliche Beanspruchung der Mutter.- 6.4.10. Wirtschaftliche Lage der Familie.- 6.4.11. Mietverhältnis.- 6.4.12. Wohnverhältnisse.- 6.4.13. Fahrzeit.- 6.4.14. Persönliche Vorsprachen sind mit Hindernissen verbunden.- 6.4.15. Fürsorge für das Kind.- 6.4.16. Gesundheitszustand der Mutter.- 6.4.17. Schwere der Behinderung des Kindes.- 6.4.18. Familienverhältnisse.- 6.4.19. Kinderzahl.- 6.4.20. Stellung des behinderten Kindes in der Geschwisterreihe.- 6.4.21. Zusammenfassung der Ergebnisse aus dem soziographischen Fragebogen.- 7. Interpretation der Ergebnisse.- 8. Literatur.- 9. Autorenverzeichnis.- 10. Sachverzeichnis.