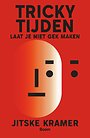Gliederung.- Einleitung: Thema und Aufbau des Buches.- I: Theoretischer und methodischer Rahmen der Studie.- 1. Integrationstheoretische Überlegungen.- 1.1 Zwischengesellschaftliche Integration bei Deutsch.- 1.2 Das Konzept der „Werte- und Interessengemeinschaft”.- 2. Die deutsch-polnische Integrationselite: Definition, Auswahl, Soziodemographie.- 2.1 Integrationseliten und vergesellschaftete Außenpolitik.- 2.2 Definition und Auswahlverfahren.- 2.2.1 „Integrationselite” als „nationale Machtelite”.- 2.2.2 Positionsmethode.- 2.2.3 Auswahl der deutschen Befragten.- 2.2.4 Auswahl der polnischen Befragten.- 2.3 Sozialstrukturelle Bedingungen der Elitenintegration.- 2.3.1 Bildung und Geschlecht.- 2.3.2 Alter.- II: Außenpolitischer Konsens.- 3. Interessen, Wertvorstellungen und Erwartungen.- 3.1 Rollen, Normen, Instrumente und internationaler Kontext.- 3.2 Instrumente der Außenpolitik.- 3.3 Normen.- 3.4 Bündnisverpflichtungen?.- 4. Sicherheitspolitik und Interessen: NATO-Erweiterung.- 4.1 Sicherheitspolitischer Kontext.- 4.2 Interessen: Nutzen des Beitritts.- 4.3 Die Zukunft: NATO-Erweiterung.- 4.4 Potentielle Konfliktherde: Kaliningrads.- 5. EU-Erweiterung.- 5.1 Wunsch und Erwartungen, Kosten und Nutzen der EU-Mitgliedschaft.- 5.2 Integrationsbereitschaft: Vertiefung.- 5.3 Integrationsbereitschaft: Erweiterung.- 6. Die bilateralen Beziehungen.- 6.1 Grenzen — verbindend oder trennend?.- 6.2 Potentielle Belastungen — Landkauf und deutschsprachige Minderheit.- 6.3 Erwartungen, Kosten und Nutzen.- 7. Konsens und Dissens — innerstaatlich und zwischenstaatlich.- 7.1 Zur Definition von Konsens und Dissens.- 7.2 Stabiler Konsens?.- III: Zwischengesellschaftliche Elitenintegration.- 8. Gesellschaftlicher Wertekonsens.- 8.1 Gesellschaftspolitische Wertorientierungen.- 8.1.1 Konfession, Religiosität und Laizismus.- 8.1.2 Links-Rechts-Materialismus und Sozialismusidee.- 8.1.3 Postmaterialismus, Ökologie und Autoritarismus.- 8.2 Demokratische Wertorientierungen.- 8.2.1 Allgemeines Wahlrecht.- 8.2.2 Minderheitenschutz und Toleranz.- 8.2.3 Subsidiarität.- 8.2.4 Verfassungspatriotismus.- 8.3 „typische Werte” — Konsens und Dissens.- 8.4 Eine pluralistische Version des Konsensbegriffs.- 8.5 Wertkonsens: zukünftige Entwicklung.- 9. Vorurteile.- 9.1 Das Deutschenbild der polnischen Befragten.- 9.2 Das Polenbild der deutschen Befragten.- 9.3 Vorurteile: zukünftige Entwicklung.- 9.4 Ursachen: Autoritarismus, Interessen, nationale Identität, Erziehung?.- 9.5 Außenpolitische Bedeutung.- 10. Verbundenheit.- 10.1 Deskriptive Ergebnisse.- 10.2 Verbundenheit: zukünftige Entwicklung.- 10.3 Bedrohung als Quelle transnationaler Identifikation?.- 10.4 Bedeutung: „missing link” von Kultur und Außenpolitik?.- 10.4.1 Beistand.- 10.4.2 Osterweiterungen.- 10.4.3 Bilaterale Themen.- 11. Kontakte.- 11.1 Kontakte: zukünftige Entwicklung.- 11.2 Vorurteile und Verbundenheit: Faktoren gesellschaftlicher Verflechtung?.- 11.3 Kontakthypothese I: veränderte Wahrnehmung?.- 11.4 Kontakthypothese II: verstärkte Verbundenheit?.- 12. Zwischengesellschaftliche Elitenintegration?.- IV: Ergebnisse und Schlussfolgerungen.- 13. Werte- und Interessengemeinschaft?.- 14. Zukünftige Entwicklung?.- Methodischer Anhang: „Konsenswahrscheinlichkeiten”.- Literatur.