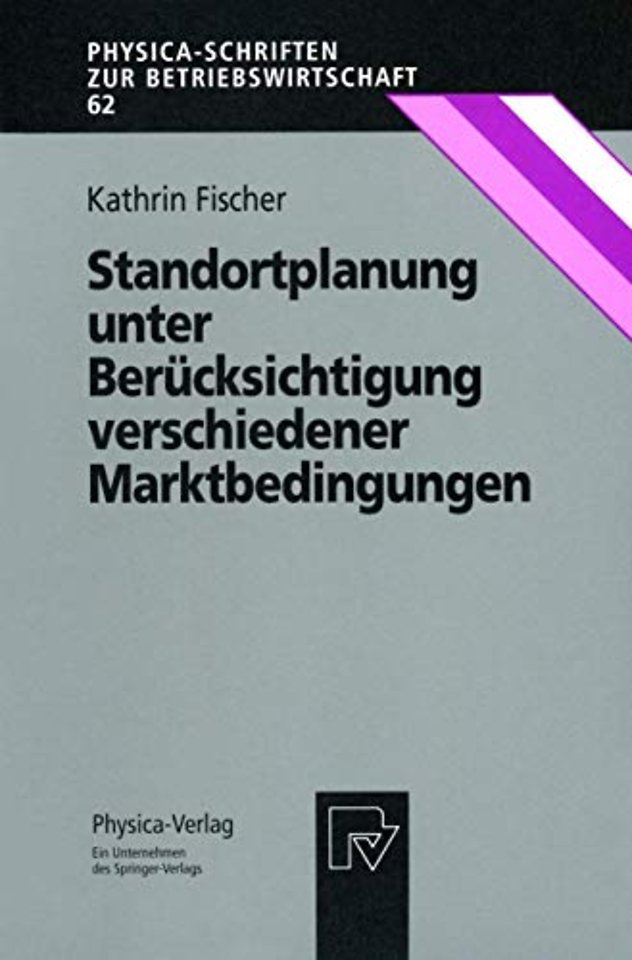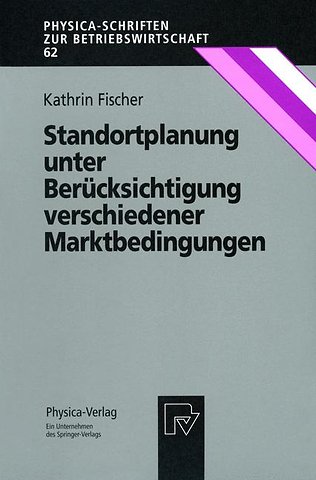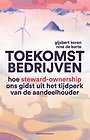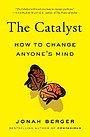1 Einleitung.- 1.1 Einführung und Ordnungsschema.- 1.2 Überblick.- 1.3 Spieltheoretischer Bezug.- 1.4 Spieltheoretische Grundlagen.- 2 Klassifizierung und Einordnung von klassischen Standortplanungsproblemen.- 2.1 überblick und Ziel.- 2.2 Standortplanung aus theoretischer und praktischer Sicht.- 2.3 Klassische Standortplanungsprobleme.- 2.4 Klassifizierungsmerkmale klassischer Standortplanungsprobleme.- 2.5 Auswertung des Merkmalskatalogs.- 2.5.1 Anwendung auf Beispielprobleme.- 2.6 Geeignete Marktbedingungen für die klassische Standortplanung.- 2.7 Erweiterungen klassischer Problemstellungen.- 2.8 Zusammenfassung.- 3 Mengenmodelle für räumlich diversifizierte Märkte.- 3.1 Abgrenzung klassischer Standortplanung gegen räumliche Gleichgewichte.- 3.2 Punktmarktmodelle.- 3.3 Markttheorie für räumlich diversifizierte Märkte.- 3.3.1 LiteraturÜberblick und Grundmodell räumlicher Gleichgewichte.- 3.4 Räumliche Oligopole.- 3.5 Standort- und Mengenmodelle.- 4 Standort- und Preismodelle für räumlich diversifizierte Märkte.- 4.1 Einleitung und überblick.- 4.2 Abgrenzung und Einordnung der Konkurrenzstandortplanung.- 4.3 Klassifizierungsmerkmale für (Preis-)Modelle räumlicher Konkurrenz.- 4.4 Gleichgewichtskonzepte für Standortplanung unter Konkurrenz.- 4.5 Das Hotelling-Modell.- 4.5.1 Das Hotellingsche Grundmodell.- 4.6 Linienmodelle räumlicher Konkurrenz.- 4.7 Standortkonkurrenz in Netzwerken.- 4.8 Kooperative Spieltheorie in der Standortplanung.- 4.9 Konkurrenzstandortplanung in der Ebene.- 10.1007/978-3-642-59265-2_5 Schlußbemerkung.- Anhang I.- Literaturüberblick zum Merkmalskatalog klassischer Probleme.- Komplementärprobleme.- II. 1 Einführung und Definitionen.- II.2 Lineare Programme als lineare Komplementärprobleme.- II.3Komplementärpivot-Verfahren für lineare Komplementärprobleme.- II.4 Iterative Verfahren zur Lösung linearer Komplementärprobleme.- Symbolverzeichnis.