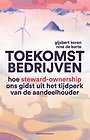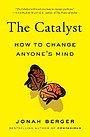I. Einleitung.- 1: Normative Analyse.- I. Grundlagen.- 1. Was ist Entwicklungshilfe?.- 2. Empirische Motive staatlicher Entwicklungshilfevergabe.- 3. Was vorweg noch gesagt werden sollte.- II. Wohlfahrtstheoretische Rechtfertigungen Staatlicher Entwicklungshilfe.- 1. Externalitäten.- 1.1. Allokative Begründung der Entwicklungshilfe.- 1.2. Empirische Kritik an der allokativen Begründung.- 1.3. Distributive Begründung der Entwicklungshilfe.- 1.3.1. Mitfreude.- 1.3.2. Mitleid.- Exkurs: Abgrenzung Mitfreude — Mitleid.- 1.3.3. Empirische Kritik an Mitfreude und Mitleid.- 1.3.4. Neid.- 1.3.5. Subjektives Ungerechtigkeitsgefühl.- 1.3.6 Empirische Kritik.- 1.4. Ineffizienzen bei Mobilität.- 1.4.1. Migration zwischen zwei Empfängerländern.- 1.4.2. Empirische Kritik an der Mobilität zwischen Empfängerländem.- 1.4.3. Migration vom Empfängerland ins Geberland.- 1.4.4. Empirische Kritik an der Migration vom Empfängerland ins Geberland.- 1.4.5. Migration zwischen zwei Geberländern.- 1.4.6. Empirische Kritik an der Gebermobilität.- 1.5. Lösungsmöglichkeiten: Ist Zentralisierung die beste Lösung?.- 1.5.1. Zentralisierung.- 1.5.2. Internationaler Finanzausgleich.- 1.5.3. Ursprungslandprinzip.- 1.6. Die Europäische Union als optimale Zentralisierungsebene.- 2. Skalenerträge.- 3. Sonstige Argumente: Unvollkommene Kapitalmärkte.- III. Fundamentalkritik.- 2: Positive Analyse.- I. Die EU-Entwicklungshilfe.- 1. Die Entstehung der EU-Entwicklungshilfe.- 1.1. Die normative Theorie als Erklärung.- 1.2. Die Interessenlage der Akteure.- 1.2.1. Frankreich.- 1.2.2. Belgien.- 1.2.3. Italien.- 1.2.4. Deutschland.- 1.2.5. Niederlande.- 1.2.6. Empfängerländer.- 1.2.7. Die EWG-Bürokratie.- 1.2.8. Ergebnis.- 2. Regionale Ausdehnung der EU-Entwicklungshilfe.- 3. Sektorale Aufteilung der EU-Entwicklungshilfe.- II. Eine Politisch-Ökonomische Analyse der EU-Entwicklungshilfeinstrumente.- 1. Transfertheorie und Entwicklungshilfe.- 1.1. Finanzielle Zusammenarbeit.- 1.2. Technische Zusammenarbeit.- 1.3. Nahrungsmittelhilfe.- 1.4. Stabex/Sysmin.- 1.5. Strukturanpassungsmaßnahmen.- 2. Erweiterung des Bruce/Waldman Modells.- 3. Entstehung der einzelnen Instrumente.- 4. Positive Analyse der Entwicklungshilfeinstrumente.- 4.1. Finanzielle und technische Zusammenarbeit.- 4.2. Flüchtlingshilfe und Soforthilfe.- 4.3. Nahrungsmittelhilfe.- 4.4. Stabex/Sysmin.- 4.5. Strukturanpassungsmaßnahmen.- 5. Ergebnisse.- III. Politisch-Ökonomischer Vergleich Bhateraler und Multilateraler Entwicklungshilfe.- 1. Bilaterale oder multilaterale Entwicklungshilfe.- 1.1. Unterschiede in den institutionellen Rahmenbedingungen.- 1.2. Wer will multilaterale Hilfe? Wirkung der Organisationsform auf die Anreizsysteme der Akteure.- 1.2.1. Geberländer.- 1.2.2. Empfängerländer.- 1.2.3. Die Präferenzen der Bevölkerung für EU-Entwicklungshilfe.- 1.2.4. Fazit: Wer bevorzugt EU-Entwicklungshilfe?.- 2. Regionale Allokation bilateraler und multilateraler Entwicklungshilfe.- 3. Sektorale Allokation bilateraler und multilateraler Entwicklungshilfe.- 4. Instrumenteneinsatz bei bilateraler und multilateraler Entwicklungshilfe.- IV. Wirkungen Institutioneller Unterschiede auf die Anreizstrukturen der Akteure in der EU und der Weltbank.- 1. Rate of Return.- 2. Die Einflußorgane der EU und der Weltbank.- 2.1. Ministerrat und Gouvemeursrat.- 2.2. Kommission und Exekutivdirektorium.- 2.3. Kommissar für Entwicklungshilfe und Weltbankpräsident.- 2.4. Generaldirektionen und Weltbankbürokratie.- 3. Institutionelle Unterschiede.- 3.1. Aufgaben/Zielsetzung.- 3.2. Vergabeinstitutionen.- 3.3. Mitglieder.- 3.4. Finanzierung und Finanzierungsinstrumente.- 4. Empirische Überprüfung.- 4.1. Bestimmungsgründe der Machtkonstellation.- 4.2. Regionale Allokation.- 4.3. Sektorale Allokation.- 4.4. Instrumenteneinsatz.- 4 5 Einfluß spezieller Geberländer.- V. Fazit.- Abkürzungsverzeichnis.