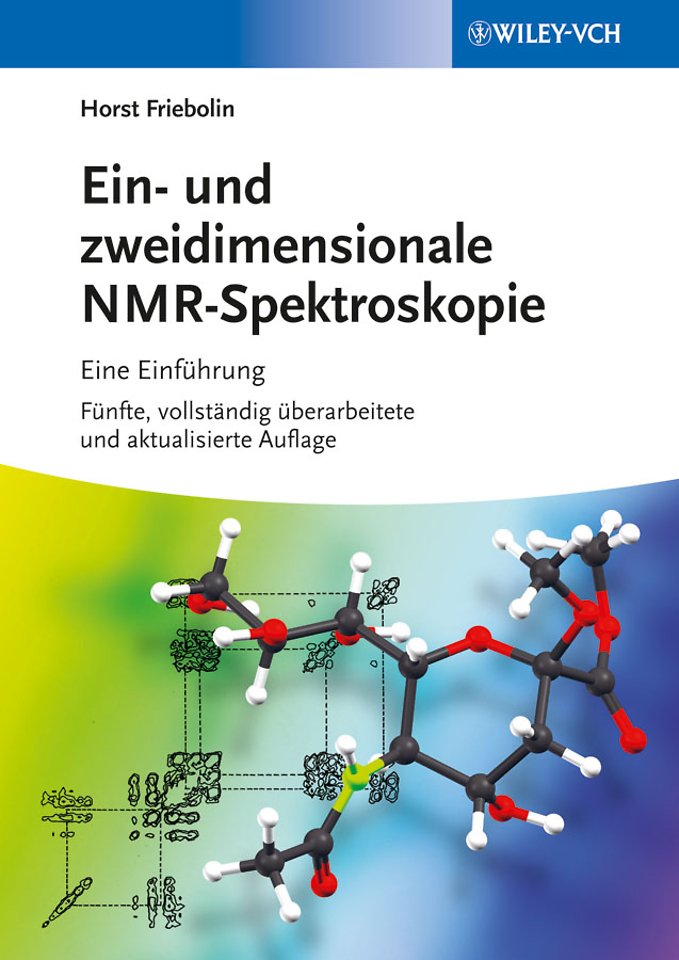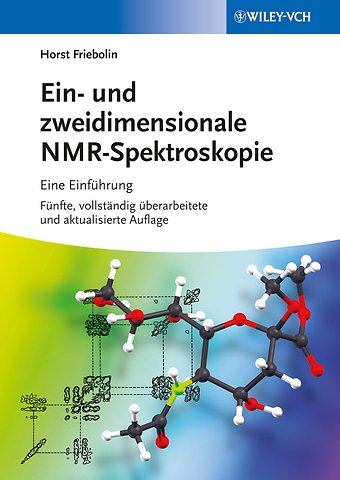Horst (Heidelberg, Germany) Friebolin,
Horst Friebolin
John Wiley & Sons
5e druk, 2013
9783527334926
Ein– und zweidimensionale NMR–Spektroskopie
Eine Einführung
Specificaties
Paperback, 452 blz.
|
Duits
John Wiley & Sons |
5e druk, 2013
ISBN13: 9783527334926
Rubricering
Verwachte levertijd ongeveer 15 werkdagen
Specificaties
ISBN13:9783527334926
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:452
Uitgever:John Wiley & Sons
Druk:5
Inhoudsopgave
1 Physikalische Grundlagen der NMR–Spektroskopie 1
<p>1.1 EinfÅhrung 1</p>
<p>1.2 Kerndrehimpuls und magnetisches Moment 2</p>
<p>1.3 Kerne im statischen Magnetfeld 4</p>
<p>1.3.1 Richtungsquantelung 4</p>
<p>1.3.2 Energie der Kerne im Magnetfeld 5</p>
<p>1.3.3 Besetzung der Energieniveaus 6</p>
<p>1.3.4 Makroskopische Magnetisierung 7</p>
<p>1.4 Grundlagen des Kernresonanz–Experimentes 7</p>
<p>1.4.1 Resonanzbedingung 7</p>
<p>1.4.2 Messprinzip 9</p>
<p>1.5 Impuls–Verfahren 10</p>
<p>1.5.1 Impuls (Angelschsisch: pulse) 10</p>
<p>1.5.2 Impulswinkel 10</p>
<p>1.5.3 Relaxation 13</p>
<p>1.5.4 Zeit– und Frequenzdomne; Fourier Transformation 15</p>
<p>1.5.5 Spektrenakkumulation 17</p>
<p>1.5.6 Impulsspektrometer 19</p>
<p>1.6 Spektrale Parameter im berblick 23</p>
<p>1.6.1 Chemische Verschiebung 23</p>
<p>1.6.1.1 Abschirmung 23</p>
<p>1.6.1.2 Referenzsubstanz und d–Skala 25</p>
<p>1.6.2 Spin–Spin–Kopplung 27</p>
<p>1.6.2.1 Indirekte Spin–Spin–Kopplung 27</p>
<p>1.6.2.2 Kopplung mit einem Nachbarkern (AX–Spinsystem) 28</p>
<p>1.6.2.3 Kopplung mit zwei quivalenten Nachbarkernen (AX2–Spinsystem) 30</p>
<p>1.6.2.4 Kopplung mit mehreren quivalenten Nachbarkernen (AXn–Spinsystem) 31</p>
<p>1.6.2.5 Multiplizittsregeln 31</p>
<p>1.6.2.6 Kopplungen zwischen drei nicht–quivalenten Kernen (AMX–Spinsystem) 32</p>
<p>1.6.2.7 Kopplungen zwischen quivalenten Kernen (An–Spinsystem) 33</p>
<p>1.6.2.8 Ordnung eines Spektrums 34</p>
<p>1.6.2.9 Kopplungen von Protonen mit anderen Kernen und 13C–Satelliten–Spektren 34</p>
<p>1.6.3 Intensitten der Resonanzsignale 35</p>
<p>1.6.3.1 1H–NMR–Spektroskopie 35</p>
<p>1.6.3.2 13C–NMR–Spektroskopie 36</p>
<p>1.6.4 Zusammenfassung 39</p>
<p>1.7 Andere Kerne 40</p>
<p>1.7.1 Kerne mit Kernspin I = 1/2 41</p>
<p>1.7.2 Kerne mit Kernspin I i 1/2 41</p>
<p>1.8 Aufgaben 43</p>
<p>1.9 Literatur zu Kapitel 1 44</p>
<p>2 Chemische Verschiebung 45</p>
<p>2.1 EinfÅhrung 45</p>
<p>2.1.1 Einfluss der Ladungsdichte auf die Abschirmung 47</p>
<p>2.1.2 Nachbargruppeneffekte 48</p>
<p>2.1.2.1 Magnetische Anisotropie von Nachbargruppen 49</p>
<p>2.1.2.2 Ringstromeffekt 51</p>
<p>2.1.2.3 Elektrischer Feldeffekt 52</p>
<p>2.1.2.4 Intermolekulare Wechselwirkungen WasserstoffbrÅcken und LÇsungsmitteleffekte 52</p>
<p>2.1.2.5 Isotopieeffekt 53</p>
<p>2.1.3 Zusammenfassung 54</p>
<p>2.2 1H–chemische Verschiebungen organischer Verbindungen 55</p>
<p>2.2.1 Alkane und Cycloalkane 55</p>
<p>2.2.2 Alkene 57</p>
<p>2.2.3 Aromaten 58</p>
<p>2.2.4 Alkine 59</p>
<p>2.2.5 Aldehyde 60</p>
<p>2.2.6 OH, SH, NH 61</p>
<p>2.3 13C–Chemische Verschiebungen organischer Verbindungen 62</p>
<p>2.3.1 Alkane und Cycloalkane 63</p>
<p>2.3.2 Alkene 64</p>
<p>2.3.3 Aromaten 66</p>
<p>2.3.4 Alkine 68</p>
<p>2.3.5 Allene 68</p>
<p>2.3.6 Carbonyl– und Carboxyverbindungen 68</p>
<p>2.3.6.1 Aldehyde und Ketone 69</p>
<p>2.3.6.2 Carbonsuren und Derivate 70</p>
<p>2.4 Spektrum und MolekÅlstruktur 72</p>
<p>2.4.1 quivalenz, Symmetrie und Chiralitt 72</p>
<p>2.4.2 Homotope, enantiotope und diastereotope Gruppen 74</p>
<p>2.4.3 Zusammenfassung 79</p>
<p>2.5 Chemische Verschiebung anderer Kerne 79</p>
<p>2.6 Aufgaben 84</p>
<p>2.7 Literatur zu Kapitel 2 85</p>
<p>3 Indirekte Spin–Spin–Kopplung 87</p>
<p>3.1 EinfÅhrung 87</p>
<p>3.2 H,H–Kopplungskonstanten und chemische Struktur 89</p>
<p>3.2.1 Geminale Kopplungen (2J(H,H)) 89</p>
<p>3.2.1.1 Abhngigkeit vom Bindungswinkel 89</p>
<p>3.2.1.2 Substituenteneffekte 90</p>
<p>3.2.1.3 Abhngigkeit von benachbarten p–Elektronen 90</p>
<p>3.2.2 Vicinale H,H–Kopplungen (3J(H,H)) 91</p>
<p>3.2.2.1 Abhngigkeit vom Torsionswinkel 92</p>
<p>3.2.2.2 Substituenteneffekte 96</p>
<p>3.2.3 H,H–Kopplungen in aromatischen Verbindungen 97</p>
<p>3.2.4 Weitreichende Kopplungen (Fernkopplungen) 98</p>
<p>3.3 C,H–Kopplungskonstanten und chemische Struktur 99</p>
<p>3.3.1 C,H–Kopplungen Åber eine Bindung (1J(C,H)) 99</p>
<p>3.3.1.1 Abhngigkeit vom s–Anteil 99</p>
<p>3.3.1.2 Substituenteneffekte 99</p>
<p>3.3.2 C,H–Kopplungen Åber zwei und mehr Bindungen 100</p>
<p>3.3.2.1 Geminale Kopplungen (2J(C,H): H C 13C) 100</p>
<p>3.3.2.2 Vicinale Kopplungen (3J(C,H): H C C 13C) 100</p>
<p>3.3.2.3 Weitreichende Kopplungen (3+nJ(C,H)) 101</p>
<p>3.3.3 C,H–Kopplungen in Benzolderivaten 101</p>
<p>3.4 C,C–Kopplungskonstanten und chemische Struktur 102</p>
<p>3.5 Korrelation von C,H– und H,H–Kopplungskonstanten 102</p>
<p>3.6 Kopplungsmechanismen 104</p>
<p>3.6.1 Kern–Elektron–Wechselwirkung 104</p>
<p>3.6.2 H,D–Kopplung 106</p>
<p>3.6.3 Kopplung und Lebensdauer eines Spin–Zustandes 107</p>
<p>3.6.4 Kopplungen durch den Raum 107</p>
<p>3.7 Kopplung anderer Kerne; Heterokopplungen 108</p>
<p>3.8 Aufgaben 110</p>
<p>3.9 Literatur zu Kapitel 3 111</p>
<p>4 Analyse und Berechnung von Spektren 113</p>
<p>4.1 EinfÅhrung 113</p>
<p>4.2 Nomenklatur 116</p>
<p>4.2.1 Systematische Kennzeichnung der Spinsysteme 116</p>
<p>4.2.2 Chemische und magnetische quivalenz 117</p>
<p>4.3 Zweispinsysteme 118</p>
<p>4.3.1 AX–Spinsystem 118</p>
<p>4.3.2 AB–Spinsystem 121</p>
<p>4.4 Dreispinsysteme 122</p>
<p>4.4.1 AX2–, AK2–, AB2– und A3–Spinsysteme 122</p>
<p>4.4.2 AMX– und ABX–Spinsystem 124</p>
<p>4.5 Vierspinsysteme 126</p>
<p>4.5.1 A2X2– und A2B2–Spinsysteme 126</p>
<p>4.5.2 AAlXXl– und AAlBBl–Spinsysteme 126</p>
<p>4.6 Spektren–Simulation und Spektren–Iteration 128</p>
<p>4.7 Analyse von 13C–NMR–Spektren 128</p>
<p>4.8 Aufgaben 129</p>
<p>4.9 Literatur zu Kapitel 4 130</p>
<p>5 Doppelresonanz–Experimente 131</p>
<p>5.1 EinfÅhrung 131</p>
<p>5.2 Spin–Entkopplung in der 1H–NMR–Spektroskopie 132</p>
<p>5.2.1 Vereinfachung von Spektren durch selektive Spin–Entkopplung 132</p>
<p>5.2.2 UnterdrÅckung des LÇsungsmittelsignals 135</p>
<p>5.3 Spin–Entkopplung in der 13C–NMR–Spektroskopie 136</p>
<p>5.3.1 1H–Breitband(BB)–Entkopplung 136</p>
<p>5.3.2 Gated–Decoupling–Experiment 137</p>
<p>5.3.3 1H–Off–Resonance–Entkopplung 138</p>
<p>5.3.4 Selektive Entkopplung in der 13C–NMR–Spektroskopie 139</p>
<p>5.4 Aufgaben 140</p>
<p>5.5 Literatur zu Kapitel 5 141</p>
<p>6 Zuordnung der 1H– und 13C–NMR–Signale 143</p>
<p>6.1 EinfÅhrung 143</p>
<p>6.2 1H–NMR–Spektroskopie 144</p>
<p>6.2.1 Problemstellung 144</p>
<p>6.2.2 Empirische Korrelationen zur Abschtzung chemischer Verschiebungen 145</p>
<p>6.2.2.1 Alkane (Regel von Shoolery) 145</p>
<p>6.2.2.2 Alkene 146</p>
<p>6.2.2.3 Benzolderivate 147</p>
<p>6.2.3 Entkopplungs–Experimente 148</p>
<p>6.2.4 Chemische Vernderung der Substanzen 149</p>
<p>6.2.5 LÇsungsmittel– und Temperatureffekte 150</p>
<p>6.2.6 Verschiebungsreagenzien 150</p>
<p>6.2.6.1 Lanthanoiden–Shift–Reagenzien (LSR) 150</p>
<p>6.2.6.2 Chirale Lanthanoiden–Shift–Reagenzien 154</p>
<p>6.3 13C–NMR–Spektroskopie 156</p>
<p>6.3.1 Problemstellung 156</p>
<p>6.3.2 Empirische Korrelationen zur Abschtzung chemischer Verschiebungen 158</p>
<p>6.3.2.1 Alkane 158</p>
<p>6.3.2.2 Alkene 161</p>
<p>6.3.2.3 Benzolderivate 162</p>
<p>6.3.3 Entkopplungsexperimente 163</p>
<p>6.3.4 T1–Messungen 163</p>
<p>6.3.5 Chemische Vernderung der Substanzen 163</p>
<p>6.3.6 LÇsungsmittel– und Temperatureffekte sowie Verschiebungsreagenzien 164</p>
<p>6.4 RechnerunterstÅtzte Spektrenzuordnung in der 1H– und 13C–NMR–Spektroskopie 165</p>
<p>6.4.1 Suche nach identischen und hnlichen Verbindungen 165</p>
<p>6.4.2 Spektrenabschtzung 166</p>
<p>6.5 Aufgaben 168</p>
<p>6.6 Literatur zu Kapitel 6 168</p>
<p>7 Relaxation 171</p>
<p>7.1 EinfÅhrung 171</p>
<p>7.2 Spin–Gitter–Relaxation der 13C–Kerne (T1) 172</p>
<p>7.2.1 Relaxationsmechanismen 172</p>
<p>7.2.2 Experimentelle Bestimmung von T1; Inversion–Recovery–Experiment 174</p>
<p>7.2.3 T1 und chemische Struktur 178</p>
<p>7.2.3.1 Einfluss der Protonen in CH–, CH2– und CH3–Gruppen 178</p>
<p>7.2.3.2 Einfluss der MolekÅlgrÇße 179</p>
<p>7.2.3.3 Segmentbeweglichkeiten 180</p>
<p>7.2.3.4 Anisotrope molekulare Beweglichkeit 180</p>
<p>7.2.4 UnterdrÅckung des Wassersignals 180</p>
<p>7.3 Spin–Spin–Relaxation (T2) 181</p>
<p>7.3.1 Relaxationsmechanismen 181</p>
<p>7.3.2 Experimentelle Bestimmung von T2; Spin–Echo–Experiment 183</p>
<p>7.3.3 Linienbreiten der Resonanzsignale 187</p>
<p>7.4 Aufgaben 189</p>
<p>7.5 Literatur zu Kapitel 7 189</p>
<p>8 Eindimensionale NMR–Experimente mit komplexen Impulsfolgen 191</p>
<p>8.1 EinfÅhrung 191</p>
<p>8.2 Grundlegende Experimente mit Impulsen und gepulsten Feldgradienten 192</p>
<p>8.2.1 Einfluss der Impulse auf die longitudinale Magnetisierung (Mz) 193</p>
<p>8.2.2 Einfluss der Impulse auf die transversalen Magnetisierungen (Mxl, Myl) 194</p>
<p>8.2.3 Spin–Locking 198</p>
<p>8.2.4 Einfluss von gepulsten Feldgradienten auf die transversalen Magnetisierungen 199</p>
<p>8.3 J–moduliertes Spin–Echo–Experiment 203</p>
<p>8.4 Spin–Echo–Experiment mit gepulsten Feldgradienten 212</p>
<p>8.5 Intensittsgewinn durch Polarisationstransfer 215</p>
<p>8.5.1 SPI–Experiment 215</p>
<p>8.5.2 INEPT–Experiment 218</p>
<p>8.5.3 Inverses, protonendetektiertes INEPT–Experiment 226</p>
<p>8.6 DEPT–Experiment 231</p>
<p>8.7 Selektives TOCSY–Experiment 236</p>
<p>8.8 Eindimensionales INADEQUATE–Experiment 238</p>
<p>8.9 Aufgaben 242</p>
<p>8.10 Literatur zu Kapitel 8 242</p>
<p>9 Zweidimensionale NMR–Spektroskopie 245</p>
<p>9.1 EinfÅhrung 245</p>
<p>9.2 Zweidimensionales NMR–Experiment 246</p>
<p>9.2.1 Prparation, Evolution und Mischung, Detektion 246</p>
<p>9.2.2 Graphische Darstellung 250</p>
<p>9.3 Zweidimensionale J–aufgelÇste NMR–Spektroskopie 252</p>
<p>9.3.1 Heteronukleare zweidimensionale J–aufgelÇste 13C–NMR–Spektroskopie 252</p>
<p>9.3.2 Homonukleare zweidimensionale J–aufgelÇste 1H–NMR–Spektroskopie 256</p>
<p>9.4 Zweidimensionale korrelierte NMR–Spektroskopie 261</p>
<p>9.4.1 Zweidimensionale heteronuklear (C,H)–korrelierte NMR–Spektroskopie (HETCOR oder C,H–COSY) 262</p>
<p>9.4.2 Zweidimensionale homonuklear (H,H)–korrelierte NMR–Spektroskopie (H,H–COSY; Long–Range COSY) 271</p>
<p>9.4.3 Inverse zweidimensionale heteronukleare (H,C)–korrelierte NMR–Spektroskopie (HSQC; HMQC) 279</p>
<p>9.4.4 (gs–)HMBC–Experiment 285</p>
<p>9.4.5 TOCSY–Experiment 290</p>
<p>9.4.6 Zweidimensionale Austausch–NMR–Spektroskopie: Die Experimente NOESY, ROESY und EXSY 292</p>
<p>9.5 Zweidimensionales INADEQUATE–Experiment 297</p>
<p>9.6 Zusammenfassung der Kapitel 8 und 9 301</p>
<p>9.7 Aufgaben 301</p>
<p>9.8 Literatur zu Kapitel 9 303</p>
<p>10 Kern–Overhauser–Effekt 305</p>
<p>10.1 EinfÅhrung 305</p>
<p>10.2 Theoretische Grundlagen 306</p>
<p>10.2.1 Zweispinsystem 306</p>
<p>10.2.2 Verstrkungsfaktor 309</p>
<p>10.2.3 Mehrspinsysteme 310</p>
<p>10.2.4 Von den ein– zu den zweidimensionalen Experimenten NOESY und ROESY 311</p>
<p>10.3 Experimentelle Aspekte 313</p>
<p>10.4 Anwendungen 314</p>
<p>10.5 Aufgaben 319</p>
<p>10.6 Literatur zu Kapitel 10 320</p>
<p>11 Dynamische NMR–Spektroskopie (DNMR) 321</p>
<p>11.1 EinfÅhrung 321</p>
<p>11.2 Quantitative Auswertung 325</p>
<p>11.2.1 Vollstndige Linienformanalyse 325</p>
<p>11.2.2 Koaleszenztemperatur TC und Geschwindigkeitskonstante kC 327</p>
<p>11.2.3 Aktivierungsparameter 329</p>
<p>11.2.3.1 Arrheniussche Aktivierungsenergie EA 329</p>
<p>11.2.3.2 Freie Aktivierungsenthalpie DG 329</p>
<p>11.2.3.3 Fehlerbetrachtung 330</p>
<p>11.2.4 Geschwindigkeitskonstanten fÅr Reaktionen mit Zwischenstufen 331</p>
<p>11.2.5 Intermolekulare Austauschprozesse 332</p>
<p>11.3 Anwendungen 333</p>
<p>11.3.1 Rotation um C,C–Einfachbindungen 333</p>
<p>11.3.1.1 C (sp3) (sp3)–Bindungen 334</p>
<p>11.3.1.2 C (sp2) (sp3)–Bindungen 334</p>
<p>11.3.1.3 C (sp2) (sp2)–Bindungen 334</p>
<p>11.3.2 Rotation um partielle Doppelbindungen 335</p>
<p>11.3.3 Inversion am Stickstoff und Phosphor 336</p>
<p>11.3.4 Ringinversion 337</p>
<p>11.3.5 Valenztautomerie 341</p>
<p>11.3.6 Keto–Enol–Tautomerie 341</p>
<p>11.3.7 Intermolekularer Protonenaustausch 343</p>
<p>11.3.8 Reaktionen und quilibrierungen 345</p>
<p>11.4 Aufgaben 348</p>
<p>11.5 Literatur zu Kapitel 11 348</p>
<p>12 Synthetische Polymere 351</p>
<p>12.1 EinfÅhrung 351</p>
<p>12.2 Taktizitt von Polymeren 351</p>
<p>12.3 Polymerisation von Dienen 355</p>
<p>12.4 Copolymere 356</p>
<p>12.5 FestkÇrper NMR an Polymeren 357</p>
<p>12.6 Aufgaben 360</p>
<p>12.7 Literatur zu Kapitel 12 360</p>
<p>13 NMR–Spektroskopie und Biochemie 363</p>
<p>13.1 EinfÅhrung 363</p>
<p>13.2 Aufklrung von Reaktionswegen in der Biochemie 364</p>
<p>13.2.1 Synthesen mit einfach 13C–markierten Vorlufern 364</p>
<p>13.2.1.1 Schwache 13C–Anreicherung 364</p>
<p>13.2.1.2 Starke 13C–Anreicherung 365</p>
<p>13.2.2 Synthesen mit doppelt 13C–markierten Vorlufern 366</p>
<p>13.3 BiomakromolekÅle 368</p>
<p>13.3.1 Peptide, Proteine 369</p>
<p>13.3.1.1 Sequenzanalyse 370</p>
<p>13.3.1.2 Dreidimensionale Struktur von Proteinen 372</p>
<p>13.3.2 Polynucleotide 373</p>
<p>13.3.3 Oligo–, Polysaccharide 375</p>
<p>13.4 Sttigungs–Transfer–Differenz–NMR (STD) (Saturation–Transfer–Difference NMR) 378</p>
<p>13.5 Aufgaben 380</p>
<p>13.6 Literatur zu Kapitel 13 380</p>
<p>14 In vivo–NMR–Spektroskopie in Biochemie und Medizin 383</p>
<p>14.1 EinfÅhrung 383</p>
<p>14.2 HochauflÇsende in vivo–NMR–Spektroskopie 384</p>
<p>14.2.1 Problemstellung 384</p>
<p>14.2.2 31P–NMR–Untersuchungen 385</p>
<p>14.2.3 1H– und 13C–NMR–Untersuchungen 388</p>
<p>14.3 Magnetische Resonanz–Tomographie 389</p>
<p>14.3.1 Grundlagen, experimentelle Aspekte 390</p>
<p>14.3.2 Anwendungen 396</p>
<p>14.4 Magnetische Resonanz–Spektroskopie, 1H–MRS 400</p>
<p>14.5 Aufgaben 402</p>
<p>14.6 Literatur zu Kapitel 14 402</p>
<p>LÇsungsvorschlge 405</p>
<p>Sachregister 419</p>
<p>1.1 EinfÅhrung 1</p>
<p>1.2 Kerndrehimpuls und magnetisches Moment 2</p>
<p>1.3 Kerne im statischen Magnetfeld 4</p>
<p>1.3.1 Richtungsquantelung 4</p>
<p>1.3.2 Energie der Kerne im Magnetfeld 5</p>
<p>1.3.3 Besetzung der Energieniveaus 6</p>
<p>1.3.4 Makroskopische Magnetisierung 7</p>
<p>1.4 Grundlagen des Kernresonanz–Experimentes 7</p>
<p>1.4.1 Resonanzbedingung 7</p>
<p>1.4.2 Messprinzip 9</p>
<p>1.5 Impuls–Verfahren 10</p>
<p>1.5.1 Impuls (Angelschsisch: pulse) 10</p>
<p>1.5.2 Impulswinkel 10</p>
<p>1.5.3 Relaxation 13</p>
<p>1.5.4 Zeit– und Frequenzdomne; Fourier Transformation 15</p>
<p>1.5.5 Spektrenakkumulation 17</p>
<p>1.5.6 Impulsspektrometer 19</p>
<p>1.6 Spektrale Parameter im berblick 23</p>
<p>1.6.1 Chemische Verschiebung 23</p>
<p>1.6.1.1 Abschirmung 23</p>
<p>1.6.1.2 Referenzsubstanz und d–Skala 25</p>
<p>1.6.2 Spin–Spin–Kopplung 27</p>
<p>1.6.2.1 Indirekte Spin–Spin–Kopplung 27</p>
<p>1.6.2.2 Kopplung mit einem Nachbarkern (AX–Spinsystem) 28</p>
<p>1.6.2.3 Kopplung mit zwei quivalenten Nachbarkernen (AX2–Spinsystem) 30</p>
<p>1.6.2.4 Kopplung mit mehreren quivalenten Nachbarkernen (AXn–Spinsystem) 31</p>
<p>1.6.2.5 Multiplizittsregeln 31</p>
<p>1.6.2.6 Kopplungen zwischen drei nicht–quivalenten Kernen (AMX–Spinsystem) 32</p>
<p>1.6.2.7 Kopplungen zwischen quivalenten Kernen (An–Spinsystem) 33</p>
<p>1.6.2.8 Ordnung eines Spektrums 34</p>
<p>1.6.2.9 Kopplungen von Protonen mit anderen Kernen und 13C–Satelliten–Spektren 34</p>
<p>1.6.3 Intensitten der Resonanzsignale 35</p>
<p>1.6.3.1 1H–NMR–Spektroskopie 35</p>
<p>1.6.3.2 13C–NMR–Spektroskopie 36</p>
<p>1.6.4 Zusammenfassung 39</p>
<p>1.7 Andere Kerne 40</p>
<p>1.7.1 Kerne mit Kernspin I = 1/2 41</p>
<p>1.7.2 Kerne mit Kernspin I i 1/2 41</p>
<p>1.8 Aufgaben 43</p>
<p>1.9 Literatur zu Kapitel 1 44</p>
<p>2 Chemische Verschiebung 45</p>
<p>2.1 EinfÅhrung 45</p>
<p>2.1.1 Einfluss der Ladungsdichte auf die Abschirmung 47</p>
<p>2.1.2 Nachbargruppeneffekte 48</p>
<p>2.1.2.1 Magnetische Anisotropie von Nachbargruppen 49</p>
<p>2.1.2.2 Ringstromeffekt 51</p>
<p>2.1.2.3 Elektrischer Feldeffekt 52</p>
<p>2.1.2.4 Intermolekulare Wechselwirkungen WasserstoffbrÅcken und LÇsungsmitteleffekte 52</p>
<p>2.1.2.5 Isotopieeffekt 53</p>
<p>2.1.3 Zusammenfassung 54</p>
<p>2.2 1H–chemische Verschiebungen organischer Verbindungen 55</p>
<p>2.2.1 Alkane und Cycloalkane 55</p>
<p>2.2.2 Alkene 57</p>
<p>2.2.3 Aromaten 58</p>
<p>2.2.4 Alkine 59</p>
<p>2.2.5 Aldehyde 60</p>
<p>2.2.6 OH, SH, NH 61</p>
<p>2.3 13C–Chemische Verschiebungen organischer Verbindungen 62</p>
<p>2.3.1 Alkane und Cycloalkane 63</p>
<p>2.3.2 Alkene 64</p>
<p>2.3.3 Aromaten 66</p>
<p>2.3.4 Alkine 68</p>
<p>2.3.5 Allene 68</p>
<p>2.3.6 Carbonyl– und Carboxyverbindungen 68</p>
<p>2.3.6.1 Aldehyde und Ketone 69</p>
<p>2.3.6.2 Carbonsuren und Derivate 70</p>
<p>2.4 Spektrum und MolekÅlstruktur 72</p>
<p>2.4.1 quivalenz, Symmetrie und Chiralitt 72</p>
<p>2.4.2 Homotope, enantiotope und diastereotope Gruppen 74</p>
<p>2.4.3 Zusammenfassung 79</p>
<p>2.5 Chemische Verschiebung anderer Kerne 79</p>
<p>2.6 Aufgaben 84</p>
<p>2.7 Literatur zu Kapitel 2 85</p>
<p>3 Indirekte Spin–Spin–Kopplung 87</p>
<p>3.1 EinfÅhrung 87</p>
<p>3.2 H,H–Kopplungskonstanten und chemische Struktur 89</p>
<p>3.2.1 Geminale Kopplungen (2J(H,H)) 89</p>
<p>3.2.1.1 Abhngigkeit vom Bindungswinkel 89</p>
<p>3.2.1.2 Substituenteneffekte 90</p>
<p>3.2.1.3 Abhngigkeit von benachbarten p–Elektronen 90</p>
<p>3.2.2 Vicinale H,H–Kopplungen (3J(H,H)) 91</p>
<p>3.2.2.1 Abhngigkeit vom Torsionswinkel 92</p>
<p>3.2.2.2 Substituenteneffekte 96</p>
<p>3.2.3 H,H–Kopplungen in aromatischen Verbindungen 97</p>
<p>3.2.4 Weitreichende Kopplungen (Fernkopplungen) 98</p>
<p>3.3 C,H–Kopplungskonstanten und chemische Struktur 99</p>
<p>3.3.1 C,H–Kopplungen Åber eine Bindung (1J(C,H)) 99</p>
<p>3.3.1.1 Abhngigkeit vom s–Anteil 99</p>
<p>3.3.1.2 Substituenteneffekte 99</p>
<p>3.3.2 C,H–Kopplungen Åber zwei und mehr Bindungen 100</p>
<p>3.3.2.1 Geminale Kopplungen (2J(C,H): H C 13C) 100</p>
<p>3.3.2.2 Vicinale Kopplungen (3J(C,H): H C C 13C) 100</p>
<p>3.3.2.3 Weitreichende Kopplungen (3+nJ(C,H)) 101</p>
<p>3.3.3 C,H–Kopplungen in Benzolderivaten 101</p>
<p>3.4 C,C–Kopplungskonstanten und chemische Struktur 102</p>
<p>3.5 Korrelation von C,H– und H,H–Kopplungskonstanten 102</p>
<p>3.6 Kopplungsmechanismen 104</p>
<p>3.6.1 Kern–Elektron–Wechselwirkung 104</p>
<p>3.6.2 H,D–Kopplung 106</p>
<p>3.6.3 Kopplung und Lebensdauer eines Spin–Zustandes 107</p>
<p>3.6.4 Kopplungen durch den Raum 107</p>
<p>3.7 Kopplung anderer Kerne; Heterokopplungen 108</p>
<p>3.8 Aufgaben 110</p>
<p>3.9 Literatur zu Kapitel 3 111</p>
<p>4 Analyse und Berechnung von Spektren 113</p>
<p>4.1 EinfÅhrung 113</p>
<p>4.2 Nomenklatur 116</p>
<p>4.2.1 Systematische Kennzeichnung der Spinsysteme 116</p>
<p>4.2.2 Chemische und magnetische quivalenz 117</p>
<p>4.3 Zweispinsysteme 118</p>
<p>4.3.1 AX–Spinsystem 118</p>
<p>4.3.2 AB–Spinsystem 121</p>
<p>4.4 Dreispinsysteme 122</p>
<p>4.4.1 AX2–, AK2–, AB2– und A3–Spinsysteme 122</p>
<p>4.4.2 AMX– und ABX–Spinsystem 124</p>
<p>4.5 Vierspinsysteme 126</p>
<p>4.5.1 A2X2– und A2B2–Spinsysteme 126</p>
<p>4.5.2 AAlXXl– und AAlBBl–Spinsysteme 126</p>
<p>4.6 Spektren–Simulation und Spektren–Iteration 128</p>
<p>4.7 Analyse von 13C–NMR–Spektren 128</p>
<p>4.8 Aufgaben 129</p>
<p>4.9 Literatur zu Kapitel 4 130</p>
<p>5 Doppelresonanz–Experimente 131</p>
<p>5.1 EinfÅhrung 131</p>
<p>5.2 Spin–Entkopplung in der 1H–NMR–Spektroskopie 132</p>
<p>5.2.1 Vereinfachung von Spektren durch selektive Spin–Entkopplung 132</p>
<p>5.2.2 UnterdrÅckung des LÇsungsmittelsignals 135</p>
<p>5.3 Spin–Entkopplung in der 13C–NMR–Spektroskopie 136</p>
<p>5.3.1 1H–Breitband(BB)–Entkopplung 136</p>
<p>5.3.2 Gated–Decoupling–Experiment 137</p>
<p>5.3.3 1H–Off–Resonance–Entkopplung 138</p>
<p>5.3.4 Selektive Entkopplung in der 13C–NMR–Spektroskopie 139</p>
<p>5.4 Aufgaben 140</p>
<p>5.5 Literatur zu Kapitel 5 141</p>
<p>6 Zuordnung der 1H– und 13C–NMR–Signale 143</p>
<p>6.1 EinfÅhrung 143</p>
<p>6.2 1H–NMR–Spektroskopie 144</p>
<p>6.2.1 Problemstellung 144</p>
<p>6.2.2 Empirische Korrelationen zur Abschtzung chemischer Verschiebungen 145</p>
<p>6.2.2.1 Alkane (Regel von Shoolery) 145</p>
<p>6.2.2.2 Alkene 146</p>
<p>6.2.2.3 Benzolderivate 147</p>
<p>6.2.3 Entkopplungs–Experimente 148</p>
<p>6.2.4 Chemische Vernderung der Substanzen 149</p>
<p>6.2.5 LÇsungsmittel– und Temperatureffekte 150</p>
<p>6.2.6 Verschiebungsreagenzien 150</p>
<p>6.2.6.1 Lanthanoiden–Shift–Reagenzien (LSR) 150</p>
<p>6.2.6.2 Chirale Lanthanoiden–Shift–Reagenzien 154</p>
<p>6.3 13C–NMR–Spektroskopie 156</p>
<p>6.3.1 Problemstellung 156</p>
<p>6.3.2 Empirische Korrelationen zur Abschtzung chemischer Verschiebungen 158</p>
<p>6.3.2.1 Alkane 158</p>
<p>6.3.2.2 Alkene 161</p>
<p>6.3.2.3 Benzolderivate 162</p>
<p>6.3.3 Entkopplungsexperimente 163</p>
<p>6.3.4 T1–Messungen 163</p>
<p>6.3.5 Chemische Vernderung der Substanzen 163</p>
<p>6.3.6 LÇsungsmittel– und Temperatureffekte sowie Verschiebungsreagenzien 164</p>
<p>6.4 RechnerunterstÅtzte Spektrenzuordnung in der 1H– und 13C–NMR–Spektroskopie 165</p>
<p>6.4.1 Suche nach identischen und hnlichen Verbindungen 165</p>
<p>6.4.2 Spektrenabschtzung 166</p>
<p>6.5 Aufgaben 168</p>
<p>6.6 Literatur zu Kapitel 6 168</p>
<p>7 Relaxation 171</p>
<p>7.1 EinfÅhrung 171</p>
<p>7.2 Spin–Gitter–Relaxation der 13C–Kerne (T1) 172</p>
<p>7.2.1 Relaxationsmechanismen 172</p>
<p>7.2.2 Experimentelle Bestimmung von T1; Inversion–Recovery–Experiment 174</p>
<p>7.2.3 T1 und chemische Struktur 178</p>
<p>7.2.3.1 Einfluss der Protonen in CH–, CH2– und CH3–Gruppen 178</p>
<p>7.2.3.2 Einfluss der MolekÅlgrÇße 179</p>
<p>7.2.3.3 Segmentbeweglichkeiten 180</p>
<p>7.2.3.4 Anisotrope molekulare Beweglichkeit 180</p>
<p>7.2.4 UnterdrÅckung des Wassersignals 180</p>
<p>7.3 Spin–Spin–Relaxation (T2) 181</p>
<p>7.3.1 Relaxationsmechanismen 181</p>
<p>7.3.2 Experimentelle Bestimmung von T2; Spin–Echo–Experiment 183</p>
<p>7.3.3 Linienbreiten der Resonanzsignale 187</p>
<p>7.4 Aufgaben 189</p>
<p>7.5 Literatur zu Kapitel 7 189</p>
<p>8 Eindimensionale NMR–Experimente mit komplexen Impulsfolgen 191</p>
<p>8.1 EinfÅhrung 191</p>
<p>8.2 Grundlegende Experimente mit Impulsen und gepulsten Feldgradienten 192</p>
<p>8.2.1 Einfluss der Impulse auf die longitudinale Magnetisierung (Mz) 193</p>
<p>8.2.2 Einfluss der Impulse auf die transversalen Magnetisierungen (Mxl, Myl) 194</p>
<p>8.2.3 Spin–Locking 198</p>
<p>8.2.4 Einfluss von gepulsten Feldgradienten auf die transversalen Magnetisierungen 199</p>
<p>8.3 J–moduliertes Spin–Echo–Experiment 203</p>
<p>8.4 Spin–Echo–Experiment mit gepulsten Feldgradienten 212</p>
<p>8.5 Intensittsgewinn durch Polarisationstransfer 215</p>
<p>8.5.1 SPI–Experiment 215</p>
<p>8.5.2 INEPT–Experiment 218</p>
<p>8.5.3 Inverses, protonendetektiertes INEPT–Experiment 226</p>
<p>8.6 DEPT–Experiment 231</p>
<p>8.7 Selektives TOCSY–Experiment 236</p>
<p>8.8 Eindimensionales INADEQUATE–Experiment 238</p>
<p>8.9 Aufgaben 242</p>
<p>8.10 Literatur zu Kapitel 8 242</p>
<p>9 Zweidimensionale NMR–Spektroskopie 245</p>
<p>9.1 EinfÅhrung 245</p>
<p>9.2 Zweidimensionales NMR–Experiment 246</p>
<p>9.2.1 Prparation, Evolution und Mischung, Detektion 246</p>
<p>9.2.2 Graphische Darstellung 250</p>
<p>9.3 Zweidimensionale J–aufgelÇste NMR–Spektroskopie 252</p>
<p>9.3.1 Heteronukleare zweidimensionale J–aufgelÇste 13C–NMR–Spektroskopie 252</p>
<p>9.3.2 Homonukleare zweidimensionale J–aufgelÇste 1H–NMR–Spektroskopie 256</p>
<p>9.4 Zweidimensionale korrelierte NMR–Spektroskopie 261</p>
<p>9.4.1 Zweidimensionale heteronuklear (C,H)–korrelierte NMR–Spektroskopie (HETCOR oder C,H–COSY) 262</p>
<p>9.4.2 Zweidimensionale homonuklear (H,H)–korrelierte NMR–Spektroskopie (H,H–COSY; Long–Range COSY) 271</p>
<p>9.4.3 Inverse zweidimensionale heteronukleare (H,C)–korrelierte NMR–Spektroskopie (HSQC; HMQC) 279</p>
<p>9.4.4 (gs–)HMBC–Experiment 285</p>
<p>9.4.5 TOCSY–Experiment 290</p>
<p>9.4.6 Zweidimensionale Austausch–NMR–Spektroskopie: Die Experimente NOESY, ROESY und EXSY 292</p>
<p>9.5 Zweidimensionales INADEQUATE–Experiment 297</p>
<p>9.6 Zusammenfassung der Kapitel 8 und 9 301</p>
<p>9.7 Aufgaben 301</p>
<p>9.8 Literatur zu Kapitel 9 303</p>
<p>10 Kern–Overhauser–Effekt 305</p>
<p>10.1 EinfÅhrung 305</p>
<p>10.2 Theoretische Grundlagen 306</p>
<p>10.2.1 Zweispinsystem 306</p>
<p>10.2.2 Verstrkungsfaktor 309</p>
<p>10.2.3 Mehrspinsysteme 310</p>
<p>10.2.4 Von den ein– zu den zweidimensionalen Experimenten NOESY und ROESY 311</p>
<p>10.3 Experimentelle Aspekte 313</p>
<p>10.4 Anwendungen 314</p>
<p>10.5 Aufgaben 319</p>
<p>10.6 Literatur zu Kapitel 10 320</p>
<p>11 Dynamische NMR–Spektroskopie (DNMR) 321</p>
<p>11.1 EinfÅhrung 321</p>
<p>11.2 Quantitative Auswertung 325</p>
<p>11.2.1 Vollstndige Linienformanalyse 325</p>
<p>11.2.2 Koaleszenztemperatur TC und Geschwindigkeitskonstante kC 327</p>
<p>11.2.3 Aktivierungsparameter 329</p>
<p>11.2.3.1 Arrheniussche Aktivierungsenergie EA 329</p>
<p>11.2.3.2 Freie Aktivierungsenthalpie DG 329</p>
<p>11.2.3.3 Fehlerbetrachtung 330</p>
<p>11.2.4 Geschwindigkeitskonstanten fÅr Reaktionen mit Zwischenstufen 331</p>
<p>11.2.5 Intermolekulare Austauschprozesse 332</p>
<p>11.3 Anwendungen 333</p>
<p>11.3.1 Rotation um C,C–Einfachbindungen 333</p>
<p>11.3.1.1 C (sp3) (sp3)–Bindungen 334</p>
<p>11.3.1.2 C (sp2) (sp3)–Bindungen 334</p>
<p>11.3.1.3 C (sp2) (sp2)–Bindungen 334</p>
<p>11.3.2 Rotation um partielle Doppelbindungen 335</p>
<p>11.3.3 Inversion am Stickstoff und Phosphor 336</p>
<p>11.3.4 Ringinversion 337</p>
<p>11.3.5 Valenztautomerie 341</p>
<p>11.3.6 Keto–Enol–Tautomerie 341</p>
<p>11.3.7 Intermolekularer Protonenaustausch 343</p>
<p>11.3.8 Reaktionen und quilibrierungen 345</p>
<p>11.4 Aufgaben 348</p>
<p>11.5 Literatur zu Kapitel 11 348</p>
<p>12 Synthetische Polymere 351</p>
<p>12.1 EinfÅhrung 351</p>
<p>12.2 Taktizitt von Polymeren 351</p>
<p>12.3 Polymerisation von Dienen 355</p>
<p>12.4 Copolymere 356</p>
<p>12.5 FestkÇrper NMR an Polymeren 357</p>
<p>12.6 Aufgaben 360</p>
<p>12.7 Literatur zu Kapitel 12 360</p>
<p>13 NMR–Spektroskopie und Biochemie 363</p>
<p>13.1 EinfÅhrung 363</p>
<p>13.2 Aufklrung von Reaktionswegen in der Biochemie 364</p>
<p>13.2.1 Synthesen mit einfach 13C–markierten Vorlufern 364</p>
<p>13.2.1.1 Schwache 13C–Anreicherung 364</p>
<p>13.2.1.2 Starke 13C–Anreicherung 365</p>
<p>13.2.2 Synthesen mit doppelt 13C–markierten Vorlufern 366</p>
<p>13.3 BiomakromolekÅle 368</p>
<p>13.3.1 Peptide, Proteine 369</p>
<p>13.3.1.1 Sequenzanalyse 370</p>
<p>13.3.1.2 Dreidimensionale Struktur von Proteinen 372</p>
<p>13.3.2 Polynucleotide 373</p>
<p>13.3.3 Oligo–, Polysaccharide 375</p>
<p>13.4 Sttigungs–Transfer–Differenz–NMR (STD) (Saturation–Transfer–Difference NMR) 378</p>
<p>13.5 Aufgaben 380</p>
<p>13.6 Literatur zu Kapitel 13 380</p>
<p>14 In vivo–NMR–Spektroskopie in Biochemie und Medizin 383</p>
<p>14.1 EinfÅhrung 383</p>
<p>14.2 HochauflÇsende in vivo–NMR–Spektroskopie 384</p>
<p>14.2.1 Problemstellung 384</p>
<p>14.2.2 31P–NMR–Untersuchungen 385</p>
<p>14.2.3 1H– und 13C–NMR–Untersuchungen 388</p>
<p>14.3 Magnetische Resonanz–Tomographie 389</p>
<p>14.3.1 Grundlagen, experimentelle Aspekte 390</p>
<p>14.3.2 Anwendungen 396</p>
<p>14.4 Magnetische Resonanz–Spektroskopie, 1H–MRS 400</p>
<p>14.5 Aufgaben 402</p>
<p>14.6 Literatur zu Kapitel 14 402</p>
<p>LÇsungsvorschlge 405</p>
<p>Sachregister 419</p>